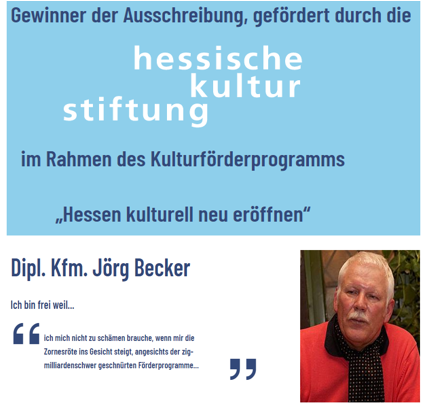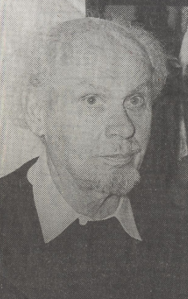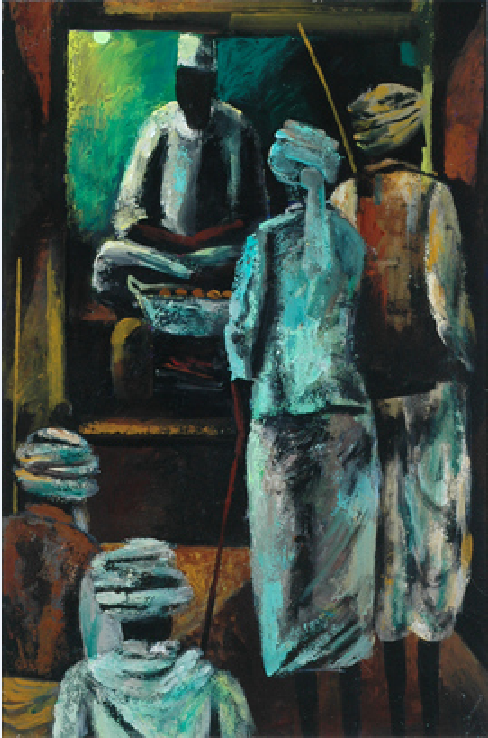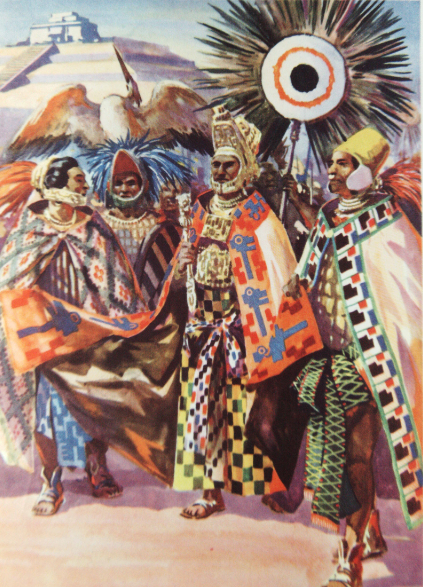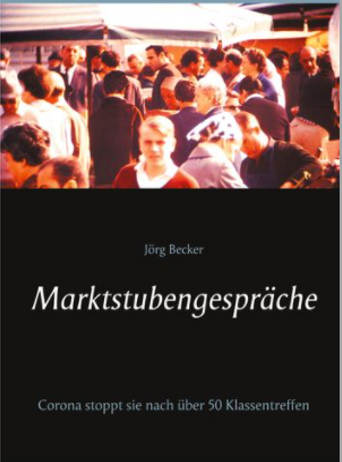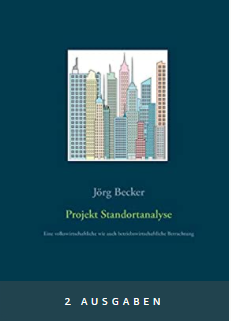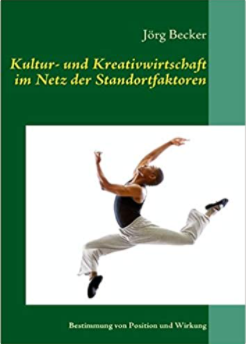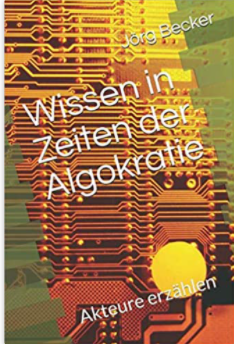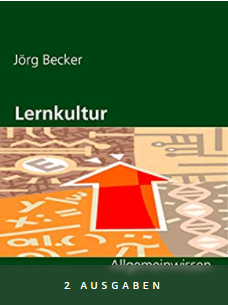Der moderne Mensch lebt in Formeln oder Zahlen. Es scheint nichts mehr zu geben, was sich nicht durch eine Abfolge von Nullen und Einsen ausdrücken ließe. Nicht alle besitzen genug Phantasie, aus sich heraus Erzählungen zu schaffen, die Erlebnisse und Ereignisse in einen größeren Zusammenhang zu stellen vermögen.
Executive Coaching
Denkstudio für strategisches Wissensmanagement
SMART: Ziele sollen spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitgebunden sein

STANDORTRÄTSEL
Wo Wirtschaft auf Standort trifft. Was macht einen Standort stark? Wer entscheidet über seine Zukunft? Und was, wenn plötzlich alles auf dem Spiel steht? Im spannenden „Standorträtsel“ treffen strategische Überlegungen, politische Machtspiele und persönliche Verstrickungen aufeinander.
Hanau – Stadt mit Geschichte, Stadt mit Zukunft. Ob alte Industriestandorte, neue Innovationszentren oder kulturelle Brüche: Die Stadt wird zum Symbol für viele Orte auf der Welt, an denen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander ringen. „Ohne gestern gibt es kein heute.“ In „Standorträtsel“ verschmelzen Rückblicke in die Geschichte mit aktuellen Herausforderungen und einem Blick auf das, was morgen möglich sein könnte.– voller Chancen, Risiken und Überraschungen.
Wirtschaftskrimi trifft Standortstrategie und Politik. Es geht nicht nur um Zahlen und Bilanzen – sondern um Macht, Entscheidungen, Chancen und Geheimnisse rund um weltweite und lokale Standorte. Wer sich für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Regionalplanung oder politische Entscheidungsprozesse interessiert, findet hier fundierte, unterhaltsam verpackte Impulse und Denkanstöße. „Standorträtsel“ richtet sich an alle, die Standort neu denken wollen, die wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Zusammenhänge verstehen – und verändern – wollen.
J. Becker Denkstudio Wirtschaft Mittelstand - KI Werkzeug zur Analyse und Entscheidungsfindung.

Ihr Potenzial liegt in der Unterstützung und Erweiterung menschlicher Fähigkeiten – aber sie bleibt ein Werkzeug, das von Menschen gesteuert und verantwortet werden muss.
Entscheidungsfindung & Problemlösung
- KI bewertet Wahrscheinlichkeiten und trifft eigenständige Entscheidungen.
- Beispiele: Schachcomputer, autonome Fahrzeuge, Finanzprognosen.
Mensch-Maschine-Interaktion
- KI kann mit Menschen kommunizieren, sei es durch Sprache (Chatbots, Sprachassistenten) oder durch Text und Bilder.
- Fortschrittliche Systeme wie GPT können sogar kreative Aufgaben übernehmen.
Fiktive Dialoge – ein paar Stunden Intensivcoaching
Denkanstöße
Wissensmanagement
Storytelling
Content
Inspiration
Diskurs
DecisionSupport
Gehirntraining – wenn es gut werden soll
Verstehen lernen
Vernetzt denken
Potenziale ausschöpfen
Komplexität reduzieren
Gestaltbar machen
Wissen transferieren
Proaktiv agieren
Unfähig, Muße zu ertragen, wird man zum Knecht einer ruhelosen Agenda, die keine weiße Flecken mehr duldet
https://www.bod.de/buchshop/catalogsearch/result/index/?p=4&q=J%C3%B6rg+Becker
J. Becker Denkstudio - Schaukasten Nr. 5 - Walter Kromp
Diplomkaufmann Jörg Becker
Executive Coaching
Autor zahlreicher Publikationen
Langjähriger Senior Manager in internationalen Management Beratungen
Inhaber Denkstudio für strategisches Wissensmanagement
BLOG KARRIERECOACHING – INTELLEKTUELLES KAPITAL https://www.rheinmaingeschichten.de/blog-karrierecoaching-intellektuelles-kapital/
J. Becker Denkstudio – strategische Marketingoptionen für KI-Autoren

Marketingstrategie
- Persönliche Marke aufbauen: Sich als Experte mit einem speziellen Thema durch Blogs, Social Media oder Podcasts positionieren.
- E-Mail-Marketing: Eine Liste von Interessenten aufbauen und sie über das Buch informieren.
- Social Media Ads: Gezielte Werbung auf Facebook, Instagram oder LinkedIn nutzen, um die eigene Zielgruppe anzusprechen.
- Content-Marketing: Artikel, Videos oder Webinare veröffentlichen, die auf das Buch aufmerksam machen.
J. #Becker #Denkstudio - #Wirtschaft #Mittelstand:
#Strategie im #KI-Zeitalter – #Erfolgsfaktoren für #Führungskräfte auf dem Prüfstand
https://buchshop.bod.de/strategie-im-ki-zeitalter-joerg-becker-9783758339707
Quantitäten und Qualitäten einer #Wirtschaftsanalyse mit KI-Dialogen – #Executive #Coaching mit #Rechenmodellen
Seit Menschengedenken ist es eine uralte Form für den Transport von Wissen und Informationen: mit Hilfe von (möglichst fesselnden) Stories, einem sogenannten Storytelling, Schlüsselergebnisse einer Analyse nachhaltig zu vermitteln und dazu beizutragen, dass sich Informationen besser einprägen und verankern. Bei der Formulierung klarer Marketingbotschaften steht SUCCESS für Say, Unify, Condense, Check, Enable, Simplify, Structure.
J. Becker Denkstudio - Blog Beckinfo für:
#Mittelständler, #Führungskräfte, #Unternehmensplaner, #Marketingmanager, #Wissensmanager, #Studierende, #Lehrkräfte, #Seminarveranstalter, #Moderatoren, #Redakteure, #Mitarbeiter, #Geldanleger, #Kreative, #Gründer, #Bewerber, #Bürgervertreter, #Kommunalverwaltungen, #Bürgermeister, #Gemeinderäte oder #Wirtschaftsförderer
https://www.beckinfo.de/blog-f%C3%BChrungskr%C3%A4fte-coaching-wissensmanagement-ist-chefsache/
Im Angesicht des Risikos hängt die Rationalität einzelner Entscheider von ihrem Wertesystem ab. Demzufolge kann ihr Verhalten dem zuwiderlaufen, was die Gesellschaft von ihnen erwartet und was lediglich das Spiegelbild einer gewissermaßen als Durchschnitt ermittelten Rationalität ist.
Viele Probleme haben ihre Ursache darin, dass sich das Ausbalancieren zwischen Denken und Fühlen, Wertvorstellungen und Verhaltensweisen nicht (mehr) im Gleichgewicht befindet. Die heutige Zeit gilt als das von rationalem Denken beherrschte wissenschaftliche Zeitalter. Rationalität gilt als das Maß aller Dinge, ein intuitives Wissen (das genauso zuverlässig und gültig sein kann) wird eher abschätzig bewertet.
direkt zum Katalog der
Deutschen Nationalbibliothek
https://portal.dnb.de/opac.htm?query=Becker+Lesebogen&method=simpleSearch
Sitemap:
Ernst Becker Stettin Hanau - Sehnsucht fliegen zu können
Mehr oder weniger unbewusst müssen wir uns der neuen Logik des Netzes beugen
Das Wissen, nicht genau zu wissen, was wir wissen, das „Denken des Undenkbaren“ zwischen Realität und Fiktion, wird von digitalen Wissenskulturen gewissermaßen selbst produziert. Im Umbau des sozio-technischen Gefüges der Informationsgesellschaft werden sogenannte Sachzwänge zu einem Sachverhalt, von dem keiner mehr so recht sagen kann, was eigentlich Sache ist.
J. Becker Denkstudio - Ausschöpfung Ressource Wissen
Um sich ein besseres Bild darüber zu machen, wo man bei der Identifizierung und Ausschöpfung der Ressource Wissen steht, wird ein systematischer Vergleich mit anderen vorgenommen. Frage: Wo gibt es große Lücken? Ein wichtiges Hilfsmittel zur Identifikation von Wissensträgern und Wissensquellen sind Netzwerke, die gleiche Interessen verfolgen. Häufig haben sich bereits Expertennetzwerke etabliert, die sich nicht an Branchen- oder Unternehmensgrenzen orientieren.
https://www.bod.de/buchshop/fluktuierendes-wissen-joerg-becker-9783752809664
Neue Geschäftsmodelle umfassen nicht nur digitale, sondern auch reale Menschen, verändern Lebensweisen und entziehen sich gewohnten geistigen Modellen und rationalen Erwartungen. Vom Data Mining vollzieht sich in Form von Reality Mining ein lautloser Übergang zur Analyse ganzer Lebensmuster realer Menschen
J. #Becker #Denkstudio - #Wirtschaft #Mittelstand:
#Strategie im #KI-Zeitalter – #Erfolgsfaktoren für #Führungskräfte auf dem Prüfstand
https://buchshop.bod.de/strategie-im-ki-zeitalter-joerg-becker-9783758339707
Quantitäten und Qualitäten einer #Wirtschaftsanalyse mit KI-Dialogen – #Executive #Coaching mit #Rechenmodellen
Vergleiche als Indikatoren für Veränderungen: Vergleichen ist ein permanenter Prozess, ständig vergleicht man: sich selbst mit anderen, mein Einkommen mit dem des Kollegen mit dem des Chefs mit dem was andere Firmen zahlen, den heutigen Partner mit dem den man einmal geheiratet hat, also die Vergangenheit mit der Zukunft oder das Wirkliche mit dem Möglichen oder dem Erträumten.
https://www.isbn.de/verlag/BoD+%E2%80%93+Books+on+Demand?autor=J%C3%B6rg+Becker&seite=1
direkt zum Wissensmanagement:
direkt zum Regionalmarketing:
https://www.derstandortbeobachter.de/
direkt zum Katalog der
Deutschen Nationalbibliothek
https://portal.dnb.de/opac.htm?query=Becker+Lesebogen&method=simpleSearch
J. Becker Denkstudio - Coaching Wissensmanagement
Diplomkaufmann Jörg Becker, Friedrichsdorf, hat Führungspositionen in der amerikanischen IT-Wirtschaft, bei internationalen Consultingfirmen und im Marketingmanagement bekleidet und ist Inhaber eines Denkstudio für strategisches Wissensmanagement zur Analyse mittelstandorientierter Businessoptionen auf Basis von Personal- und Standortbilanzen.Die Publikationen reichen von unabhängigen Analysen bis zu umfangreichen thematischen Dossiers, die aus hochwertigen und verlässlichen Quellen zusammengestellt und fachübergreifend analysiert werden. Zwar handelt es sich bei diesen Betrachtungen (auch als Storytelling) vor allem von Intellektuellem (immateriellen) Kapital nicht unbedingt um etwas Neues, aber um etwas Anderes. Denn um neue Wege zu gehen, reicht es manchmal aus, verschiedene Sachverhalte, die sich bewährt haben, miteinander neu zu kombinieren und fachübergreifend zu durchdenken. Zahlen ja, im Vordergrund stehen aber „weiche“ Faktoren: es wird versucht, Einflussfaktoren nicht nur als absolute Zahlengrößen, sondern vor allem in ihrer Relation zueinander und somit in ihren dynamischen Wirkungsbeziehungen zu sehen.
J. #Becker #Denkstudio - #Wirtschaft #Mittelstand:
#Strategie im #KI-Zeitalter – #Erfolgsfaktoren für #Führungskräfte auf dem Prüfstand
https://buchshop.bod.de/strategie-im-ki-zeitalter-joerg-becker-9783758339707
Quantitäten und Qualitäten einer #Wirtschaftsanalyse mit KI-Dialogen – #Executive #Coaching mit #Rechenmodellen
Auch scheinbar Nebensächliches wird aufmerksam beobachtet. In der unendlichen Titel- und Textfülle im Internet scheint es kaum noch ein Problem oder Thema zu geben, das nicht bereits ausführlich abgehandelt und oft beschrieben wurde. Viele neu hinzugefügte und generierte Texte sind deshalb zwangsläufig nur noch formale Abwandlungen und Variationen. Das Neue und Innovative wird trotzdem nicht untergehen. Die Kreativität beim Schreiben drückt sich dadurch aus, vorhandenes Material in vielen kleinen Einzelteilen neu zu werten, neu zusammen zu setzen, auf individuelle Weise zu kombinieren und in einen neuen Kontext zu stellen. Ähnlich einem Bild, das zwar auf gleichen Farben beruhend trotzdem immer wieder in ganz neuer Weise und Sicht geschaffen
Texte werden also nicht nur immer wiederholt sequentiell gelesen, sondern entstehen in neuen Prozess- und Wertschöpfungsketten. Das Neue folgt aus dem Prozess des Entstehens, der seinerseits neues Denken anstößt. Das Publikationskonzept für eine selbst entwickelte Tool-Box: Storytelling, d.h. Sach- und Fachthemen möglichst in erzählerischer Weise und auf (Tages-) Aktualität bezugnehmend aufbereiten. Mit akademischer Abkapselung haben viele Ökonomen es bisher versäumt, im Wettbewerb um die besseren Geschichten mitzubieten. Die in den Publikationen von Jörg Becker unter immer wieder anderen und neuen Blickwinkeln dargestellten Konzepte beruhen auf zwei Grundpfeilern: 1. personenbezogener Kompetenzanalyse und 2. raumbezogener Standortanalyse. Als verbindende Elemente dieser beiden Grundpfeiler werden a) Wissensmanagement des Intellektuellen Kapitals und b) bilanzgestützte Decision Support Tools analysiert. Fiktive Realitäten können dabei manchmal leichter zu handfesten Realitäten führen. Dies alles unter einem gemeinsamen Überbau: nämlich dem von ganzheitlich durchgängig abstimmfähig, dynamisch vernetzt, potential- und strategieorientiert entwickelten Lösungswegen.
Seit 1990 veröffentlichte Jörg Becker zahlreiche Artikel, Aufsätze, Beiträge, Analysen, Bücher in vielen renommierten Publikationen, Fachzeitschriften, Handbüchern oder Verlagen wie beispielsweise Handbuch für EDV-Leiter, Proft – Fachzeitschrift für Unternehmensführung, Erfolg- Büromagazin für den Chef und Leitende in der Industrie, Controller Magazin, Zeitschrift Kostenrechnungspraxis, dfz Wirtschaftsmagazin, Computerwoche, Personalwirtschaft, Zeitschrift für Planung, IC-Wissen, Controller-Handbuch, Marktforschung & Management, Computer Magazin, Blick durch die Wirtschaft, Handbuch Revision Controlling und Consulting, Chefbüro, Bilanzbuchhalter, Harvard Manager, Manager-Seminare, acquisa, Organisationshandbuch für EDV-Leiter, Personalcomputer, Der Controlling-Berater, Wirtschaftsberater im dtv, Praxis des Rechnungswesens, Organisationshandbuch Informationsverarbeitung, Handbuch „Controlling-das Unternehmen mit Zahlen führen“, Handbuch „Marketing und Vertriebscontrolling“, Praxis-Handbuch Unternehmensführung, Wirtschaft & Produktivität, Mensch & Büro, Business Computing, Bilanz & Buchhaltung, PC-Magazin, Marketing- und Vertriebscontrolling, absatzwirtschaft – Zeitschrift für Marketing, Süddeutsche Zeitung, ISDN-Handbuch, Handwerk-extra, Praxishandbuch IV-Management, geldinstitute, c´t Magazin, Computer Zeitung, Geld & Steuern, it Management, Organisations- und Muster-Handbuch für die EDV-Praxis, Finanzierungs-Berater, LBW Marketing, iX – Magazin für professionelle Informationstechnik, Personal Wirtschaftsverlag, office, Erfolgsreiches Verkaufsmanagement, Das Personalbüro, Das neue AntiSteuer-Lexikon von A-Z, management berater, LBW „PC im Betrieb von A-Z“, Der Einkaufs- und Lagerwirtschaftsberater, Tägliche Betriebspraxis, Praxis-Handbuch „Arbeitszeitgestaltung“, Der Umweltschutz-Berater, Das innovative Unternehmen, HR-Services, CADplus – Fachmagazin für Business + Engineering.
Aktuelle Fachbeiträge u.a.: Handbuch für Unternehmensberatung, Sozialwirtschaft – Zeitschrift für Führungskräfte, wissensmanagement – Magazin für Digitalisierung, Vernetzung und Collaboration, Wissenschaftsmanagement – Zeitschrift für Innovation.
Im Bereich Weiterbildung für Führungskräfte führte Jörg Becker eine Reihe von Seminaren durch u.a. für: DVS-Workshop Deutsche Verkaufsleiter Schule – Methoden und Techniken einer modernen Vertriebsplanung, Konferenz Management Circle – Marketing- und Vertriebsinformationssysteme, Seminarzentrum für Unternehmensführung – Zukunftsorientiertes Controlling, Konferenz management forum – Vertriebscontrolling, Konferenz Management Circle – Marketing Controlling.
Heute ist Jörg Becker Inhaber eines Denkstudios für strategisches Wissensmanagement zur Analyse mittelstandsorientierter Businessoptionen auf der Basis von Personalbilanzen und Standortbilanzen.
J. Becker Denkstudio - Blog Beckinfo für:
#Mittelständler, #Führungskräfte, #Unternehmensplaner, #Marketingmanager, #Wissensmanager, #Studierende, #Lehrkräfte, #Seminarveranstalter, #Moderatoren, #Redakteure, #Mitarbeiter, #Geldanleger, #Kreative, #Gründer, #Bewerber, #Bürgervertreter, #Kommunalverwaltungen, #Bürgermeister, #Gemeinderäte oder #Wirtschaftsförderer
https://www.beckinfo.de/blog-f%C3%BChrungskr%C3%A4fte-coaching-wissensmanagement-ist-chefsache/
 Wissensbasierte Ökonomie
Region RheinMain
Lokale Standortbeobachtungen
Standortbilanz u. Personalbilanz
Wissensbasierte Ökonomie
Region RheinMain
Lokale Standortbeobachtungen
Standortbilanz u. Personalbilanz