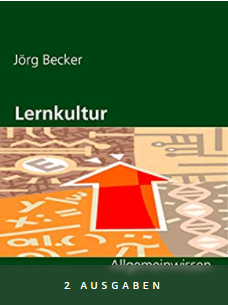Eine Volkswirtschaft ist ein sich ständig veränderndes und entwickelndes System, abhängig von den sich wandelnden ökonomischen und gesellschaftlichen Systemen, in die es eingebettet ist. Will man die zahllosen Wirkungsbeziehungen verstehen, braucht man ein selbst wandlungsfähiges Gedankengebäude, das sich zeitnah neuen Situationen anpassen kann. Man muss sich die Frage stellen, ob es eine Wirtschaftswissenschaft geben kann, die nicht ausschließlich auf Messungen beruht.
BUSINESS COACHING –
Decision Support mit Ansage
https://www.bod.de/buchshop/business-coaching-joerg-becker-9783739223452
Diplomkaufmann Jörg Becker
Executive Coaching
Autor zahlreicher Publikationen
Langjähriger Senior Manager in internationalen Management Beratungen
Inhaber Denkstudio für
strategisches Wissensmanagement
J. Becker Denkstudio – KI-Balance zwischen Chancen & Risiken

KI hat das Potenzial, Wirtschaft und Gesellschaft fundamental zu verbessern – durch Innovation, Effizienz und neue Möglichkeiten. Gleichzeitig müssen Risiken wie Arbeitsplatzverluste, Datenmissbrauch und ethische Dilemmata aktiv gesteuert werden.
Kernfrage für die Zukunft:
Wie schaffen wir ein Gleichgewicht zwischen KI-getriebener Effizienz und menschlicher Verantwortung?
Welchen Einfluss hat KI auf den Markt für Sachbücher?
Künstliche Intelligenz verändert den Markt für Sachbücher in mehrfacher Hinsicht – sowohl in der Erstellung als auch im Vertrieb und Konsum. Zum Beispiel:
KI als Werkzeug für Autoren
Beschleunigung der Recherche
KI kann große Datenmengen schnell durchsuchen und relevante Informationen herausfiltern.
Autoren erhalten strukturierte Analysen und können komplexe Zusammenhänge effizienter erfassen.
Unterstützung beim Schreiben
KI-gestützte Textgeneratoren (z. B. ChatGPT) helfen beim Entwurf von Kapiteln, Zusammenfassungen oder Stiloptimierung.
Sprachmodelle können Vorschläge machen, Argumentationen präzisieren oder kreative Inspiration liefern.
J. #Becker #Denkstudio – #Wirtschaft #Mittelstand: Resilienz und Kundenbeziehungen auf dem Prüfstand:

Lieferketten & Resilienz
▢ Lieferanten
diversifizieren und Abhängigkeiten reduzieren
▢ Lagerbestände
strategisch optimieren
▢ Risiken durch
geopolitische Unsicherheiten bewerten
Finanzmanagement & Liquiditätssicherung
▢ Finanzierungskosten
optimieren und alternative Kapitalquellen nutzen
▢ Kostenstrukturen
überprüfen und Effizienz steigern
▢ Krisenreserven
aufbauen und Liquidität sicherstellen
Kundenorientierung & Marketing
▢ Kundenfeedback aktiv
nutzen und Angebote personalisieren
▢ Digitale
Marketingkanäle und Social Media gezielt einsetzen
▢ Markenstrategie
authentisch und nachhaltig gestalten
J. #Becker #Denkstudio - #Wirtschaft #Mittelstand:
#Kreativwirtschaft und #Wirtschaftsstandort im KI-Gespräch – #Analysen, #Fallbeispiele, #Handlungsempfehlungen
#Gründen im KI-Gespräch – Skizzen einer #Innovationsgesellschaft
https://buchshop.bod.de/gruenden-im-ki-gespraech-joerg-becker-9783769304039
Auf der einen Seite die Ängste, dass aus Informationspartikeln Datenraster erwachsen, weiter zu unentrinnbaren Netzen versponnen werden und Menschen dadurch zu willenlosen Kauf- und Konsummaschinen reduziert werden. Auf der anderen Seite die manchmal schon krankhafte Sucht, im Orbit des Internet nicht vergessen, sondern auf möglichst vorderen Plätzen der Suchergebnisse wahrgenommen zu werden: denn nur so können aus dem unendlichen Datenuniversum heraus neue Gedanken entstehen.
Zeitalter der Beschleunigung und Entgrenzung
https://www.bod.de/buchshop/zeitalter-der-beschleunigung-und-entgrenzung-joerg-becker-9783748118879
Rohstoffe und Naturschätze sind endlich
Was führte zu der Einsicht, dass unser Planet endlich ist und daher die reale Gefahr besteht, dass seine Rohstoffe und Naturschätze erschöpfen werden – vor allem, wenn Menschen auch in Zukunft immer zahlreicher und gleichzeitig immer wohlhabender werden wollen? Eine tragende Säule ist die Verbindung von Technologie und Kapitalismus. Eine weitere Säule ist die zunehmende Ausschöpfung von Intellektuellem Kapital, dem einzigen Rohstoff, der sich durch Gebrauch vermehren lässt. Ein umfassendes Wissensmanagement trägt dazu bei, Menschen zu informieren, damit sie sich bei ihren Entscheidungen von den besten verfügbaren Erkenntnissen leiten lassen.
https://www.bod.de/buchshop/catalogsearch/result/index/?p=4&q=J%C3%B6rg+Becker
Blog Karrierecoaching - Intellektuelles Kapital
BLOG KARRIERECOACHING – INTELLEKTUELLES KAPITAL https://www.rheinmaingeschichten.de/blog-karrierecoaching-intellektuelles-kapital/
Fiktive Dialoge - ein paar Stunden Intensivcoaching
Denkanstöße
Wissensmanagement
Storytelling
Content
Inspiration
Diskurs
DecisionSupport
Gehirntraining - wenn es gut werden soll
Verstehen lernen
Vernetzt denken
Potenziale ausschöpfen
Komplexität reduzieren
Gestaltbar machen
Wissen transferieren
Proaktiv agieren
J. Becker Denkstudio Standortanalyse - strukturierte Tools
Eine Standortbilanz ist bereits vom Ansatz her auf eine ganzheitliche Betrachtungsweise hin angelegt. Das Schwergewicht wird insbesondere auf die sogenannten „weichen“ Standortfaktoren gelegt. Da bereits standardmäßig immer die fünf Cluster Geschäftsprozesse, Erfolgsfaktoren, Humanfaktoren, Strukturfaktoren und Beziehungsfaktoren strukturiert sind, kann ein Standort nicht auf mehr oder weniger willkürlich herausgesuchte Einzelaspekte reduziert werden. Somit können sowohl vielseitige Informationsanforderungen aus unterschiedlichsten Richtungen als auch zahlreiche Planungs- und Entscheidungszwecke abgedeckt werden.
Standortanalyse mit Wissensmanagement des Immateriellen Vermögens
Uni Frankfurt - Abi63 Hanau, Frankfurt, Friedrichsdorf
Die Menschen erleben so etwas wie eine Sprung-Digitalisierung. Das heißt, immer mehr Prozesse, ob bargeldloses Zahlen, Bankgeschäfte im Internet, Online-Handel und, und….., werden digitalisiert. Eine robotisierte Fabrik mit weniger Menschen ist zudem auch weniger anfällig für das Virus. Zwar dacht man bisher, allmähliche Rationalisierungseffekte würden durch demographischen Wandel und neue Geschäftsfelder kompensiert. Aber das Coronavirus dürfte diese Entwicklung noch einmal deutlich beschleunigen. Schon allein aus Hygienegründen sind Firmen gezwungen, künftig mehr Roboter einzusetzen. Auch Verbraucher werden, um Distanz zu wahren, mehr und mehr digitale Dienstleistungen bevorzugen. Wobei sich dieser Prozess aber nicht auf allen Berufsfeldern gleichmäßig beschleunigen dürfte.
https://www.bod.de/buchshop/catalogsearch/result/index/?p=5&q=J%C3%B6rg+Becker
Die Entwicklung des Standortes ist das Ergebnis einer Vielzahl von Faktoren. Anhand von sowohl wachstumsbeschleunigenden als auch bremsenden Einflussfaktoren sollte jeder Standort für sich genau analysieren, ob er bisher langsamer oder schneller gewachsen ist, sich besser oder schlechter entwickelt hat, als die Standortfaktoren es ihm erlaubt hätten.
J. Becker Denkstudio
Es geht um gemeinsames Wissen über die Wirkungszusammenhänge in konkreten Problemstellungen und Informationsanforderungen. Um eine breite gemeinsame Informationsschnittmenge für die Nutzung von Indikatoren als Kommunikationsplattform. Um die genaue Justierung und Abstimmung zwischen Informationsqualität, Informationsmenge, Informationstiefe und Informationsdichte. Um die Sicherstellung einer integrierten und konsistenten Daten-Plattform. Um zeitnahes Recherchieren möglicher Veränderungen und deren Hintergründe. Um Forcierung einer Träger-Funktion der Indikatoren für alle übrigen Standortdaten und -informationen. Um Verbesserung und Optimierung der Datenqualität und Nachvollziehbarkeit von Standortinformationen. Um Transformation der Indikatorauswertungen in die Entscheidungsprozesse des Standortalltages.
https://www.bod.de/buchshop/catalogsearch/result/index/?p=15&q=J%C3%B6rg+Becker
Der Glaube daran, dass Computer demnächst ein Bewusstsein entwickeln werden und Menschen dann sagen, wo´s langgeht, ist noch fern (Zumindest außerhalb des Silicon Valley). Wenn den Menschen im Wesentlichen ausmacht, was in seinem Gehirn vorgeht, ließe sich daraus vielleicht folgern: Wenn es nur gelingt, genauso viel Daten zusammenzubringen wie das menschliche Gehirn (Schätzungseise 10 hoch 16 Operationen pro Sekunde), könne man Bewusstsein auch künstlich erzeugen.
https://www.isbn.de/verlag/BoD+%E2%80%93+Books+on+Demand?autor=J%C3%B6rg+Becker&seite=1
Damit Daten zu Informationen werden, brauchen sie hierfür auch einen Empfänger, der sie versteht (eine von einem möglichen Adressaten losgelöste Information ist ja bereits ein Widerspruch in sich). Erleben ist damit weit mehr als nur eine Datensammlung im Gehirn, die Simulation von Funktionen des Lebens ist noch lange nicht dasselbe wie das Leben selbst.
https://www.bod.de/buchshop/catalogsearch/result/index/?p=25&q=J%C3%B6rg+Becker
J. Becker Denkstudio - digitalisierte Vernetzung
Die durch Digitalisierung maximierten Möglichkeiten stellen die Gesellschaft vor neue Anforderungen. Denn vernetzte Lebensweisen sind nicht nur flexibel und grenzüberschreitend, sondern auch anspruchsvoll (anstrengend). Vernetzung macht die Welt nicht nur schneller, sonder auch komplexer. Diese digitalisierte Welt kann man nur richtig verstehen, wenn man lernt, selbst komplexer (vernetzter) zu denken. Die Vernetzung muss man als sozialen Wandlungsprozess (der neue Verbindungen und Beziehungen schafft) begreifen, man braucht eine neue Perspektive, so etwas wie einen „synthetischen Blick“ des ganzheitlichen Denkens.
https://www.bod.de/buchshop/fluktuierendes-wissen-joerg-becker-9783752809664
Potenzial eines Standortes
Als alles entscheidende Frage steht im Raum: wie, wem und mit welchen Instrumenten gelingt es, das kreative Potenzial, immaterielle Vermögen/ Kapital des Standortes (quantitativ nachprüfbar, mit allen Wirkungsbeziehungen) offen darzulegen ? Nicht zuletzt wird auch der Umfang einer Standortbilanz davon abhängen, ob sich ihr Bilanzierungsbereich auf eine Kommune, einen Kreis oder eine ganze Region erstreckt. Denkbar wäre auch, gemarkungsübergreifende kommunale Kooperationen in einer eigens dafür zusammen gefassten Standortbilanz darzustellen. Als Ausgangspunkt muss Klarheit darüber bestehen, an welchen Stellen eines Standortes man überhaupt Sensoren anlegen will.
https://www.isbn.de/verlag/BoD+%E2%80%93+Books+on+Demand?autor=J%C3%B6rg+Becker&seite=1
Kluge Führungskräfte bremsen die Lauten aus und eröffnen den Stillen Raum, indem sie beispielsweise vor einer Besprechung schriftliche Statements einfordern. Da haben Introvertierte oft die Nase vorn, denn schriftliche Schaumschlägereien sind rascher entlarvt als mündliche. Denn die Stillen haben oft viel zu sagen: Ohne diese Menschen wäre weder die Radioaktivität entdeckt worden noch Google entstanden. Eigenschaften wie beispielsweise Konzentration, analytisches Denken, beharrliches Handeln und viele andere dieser Art mehr werden häufiger gerade den Introvertierten zugeschrieben.
Baupläne für Unverstandenes
https://www.bod.de/buchshop/bauplaene-fuer-unverstandenes-joerg-becker-9783756236107
Grenzen des elektronischen Weltwissens - Weltkommunikationsraum und Speicheruniversum: In der Digitalgesellschaft heißt es bezüglich der Verfügbarkeit von Daten und Wissen oft: ewig, alles, überall! (Idee eines barrierelosen Weltkommunikationsraumes im unendlichen Speicheruniversum). Wissenschaftler verweisen bei einer mehr differenzierten Betrachtung allerdings darauf hin, dass eine (unendliche) Langzeitarchivierung allen Wissens dieser Welt durchaus nicht gesichert sei, sondern vielmehr sogar Gefahren drohten, „geschichtslos zu werden“.
Abschöpfung von Daten unterhalb der Wahrnehmungsschwelle
Die Informationen, die Nutzer durch ihr Alltagsverhalten laufend en passant erzeugen, werden in Zeiten der Digitalisierung systematisch abgeschöpft. Bisher unter der Wahrnehmungsschwelle liegende Daten werden dabei durch Analysetechniken zu potenziell wertvolle Informationen, beispielsweise um Produkte zu verbessern oder neue zu entwickeln, Prozesse zu optimieren oder um Trends und Entwicklungen schneller zu erkennen.
https://www.bod.de/buchshop/catalogsearch/result/index/?p=9&q=J%C3%B6rg+Becker
direkt zum Katalog der
Deutschen Nationalbibliothek
https://portal.dnb.de/opac.htm?query=Becker+Lesebogen&method=simpleSearch
Sitemap:
Standort- Kennzahlen dürfen nicht isoliert interpretiert werden, sondern müssen sich immer einer bestimmten Systematik (wie beispielsweise einem System der Standortökonomie) zuordnen lassen. Unter dem Einfluss der Globalisierung geraten Standorte unter einen immer stärkeren Konkurrenzdruck um die Gunst von Unternehmen, die Arbeitsplätze schaffen, laufende Einnahmen für den Haushalt kreieren und an dem Standort investieren sollen. Der Konkurrenzkampf um Unternehmensansiedlungen findet heute nicht mehr nur auf regionaler Ebene, sondern immer mehr auch auf globaler Ebene statt: da Unternehmen global agieren, müssen sich auch deutsche Standorte mit solchen überall in der Welt vergleichen. Je besser sich ein Standort im Kampf um Unternehmensstandorte schlägt, desto besser sind die Zukunftsaussichten für diesen Standort.
Ein Wissensbilanz-Management-System erlaubt es Unternehmen, strategische Ziele zu erkennen und umzusetzen D. Ein solches Planungssystem ermöglicht außerdem die langfristige Erfolgskontrolle der angewandten Strategie. Um eine Messlatte zu haben, muss das Unternehmen vor der Implementierung eines Wissensbilanz-Systems erst seine zu erreichenden Ziele definieren und die dafür notwendigen Mittel und Maßnahmen festlegen. Die Performance wird dann über einen längeren Zeitraum an diesen Parametern gemessen, d.h. Daten werden gesammelt, analysiert und die Resultate in entscheidungsrelevanter Form präsentiert.
https://www.isbn.de/verlag/BoD+%E2%80%93+Books+on+Demand?autor=J%C3%B6rg+Becker&seite=1
Immer häufiger werden wir uns der Unfähigkeit bewusst, die Konsequenzen der Informationen, die wir schon besitzen, zu erkennen. Wir verlassen das Zeitalter der Statistiken und aggregierten Daten und treten ein in das Zeitalter der Echtzeit und disaggregierten Daten. Das Zauberwort für den Siegeszug von Computersimulationen heißt „Prädiktion“, die umso besser wird, je mehr Daten vorliegen.
„Zu den wichtigsten Akteuren in der neuen Datenwirtschaft zählen die digitalen Plattformen: Sie führen verschiedene Marktteilnehmer – etwa Nachrichtenlieferanten und Werbetreibende oder die Nutzer von Vergleichsportalen, sozialen Medien oder Online-Suchdiensten und Werbetreibende – zusammen.“ Grundlage ist die Verwertung von personenbezogenen Daten (über Nutzer und Nutzerverhalten), die damit zu einer neuen Form des Entgelts geworden sind. „Das im Internet so ungemein erfolgreiche Geschäftsmodell „Leistung gegen Daten“ steht tatsächlich nur scheinbar für eine neue „Kostenloskultur“.
https://www.bod.de/buchshop/catalogsearch/result/index/?p=9&q=J%C3%B6rg+Becker
„Die Post-Gutenberg-Galaxis ist heute von schwarzen Löchern perforiert. Viele digitale Projekte sind Friedhöfe“. Die Digital-Euphorie verleite dazu, das im Netz repräsentierte Wissen zu überschätzen: so würden beispielsweise Archivbestände nur zu einem Bruchteil ins elektronische Format übersetzt. Da diese Transferlücke über neunzig Prozent betrage, sei es ein vermessenes Vorteil, dass nur das im Netz Vorhandene existiert. Vor allem können bei Formatwechseln problematische Datenverluste entstehen. Denn mit der Migration sinkt die Lesbarkeit, wächst der Abstand zum Original.
direkt zum Wissensmanagement:
direkt zum Regionalmarketing:
https://www.derstandortbeobachter.de/
direkt zum Katalog der
Deutschen Nationalbibliothek
https://portal.dnb.de/opac.htm?query=Becker+Lesebogen&method=simpleSearch
Angesichts sich immer schneller und immer höher auftürmender wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Probleme sind manche Denker und Experten der Meinung, dass ihr Ideenschrank mittlerweile leer sei, dass ihr Hauptstrom von Ideen sich für eine umfassende Lösung in Dutzende von kleinen Bächen und Bächlein so sehr aufgesplittert hat, dass er an einigen Stellen bereits ausgetrocknet ist. Als Ursache ihrer Verwirrung nennen Intellektuelle neue Umstände oder den unvorhersehbaren Lauf der Geschehnisse.
 Wissensbasierte Ökonomie
Region RheinMain
Lokale Standortbeobachtungen
Standortbilanz u. Personalbilanz
Wissensbasierte Ökonomie
Region RheinMain
Lokale Standortbeobachtungen
Standortbilanz u. Personalbilanz