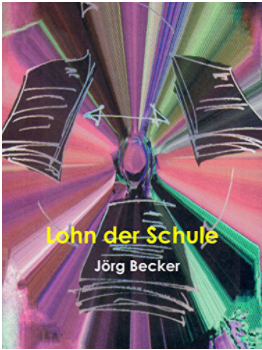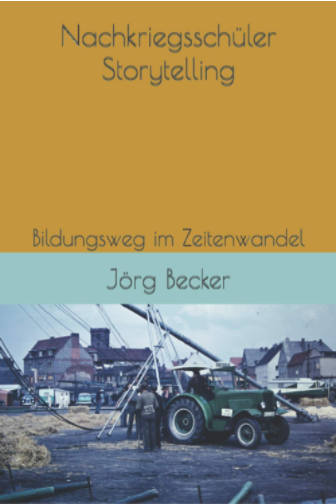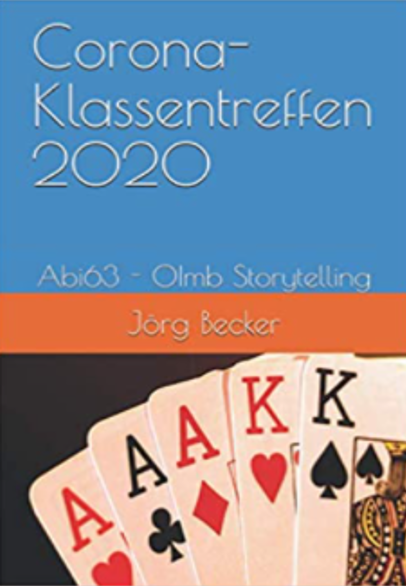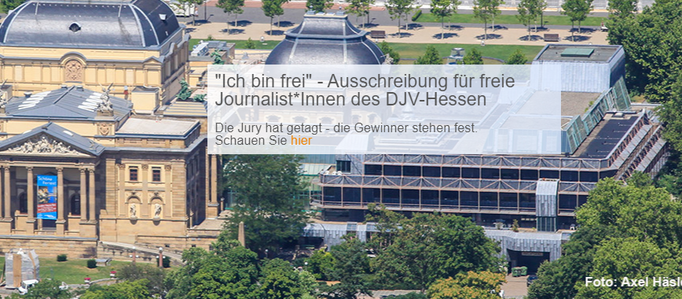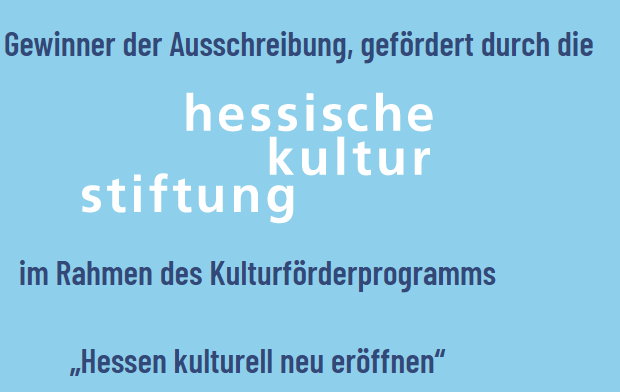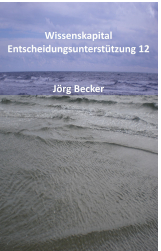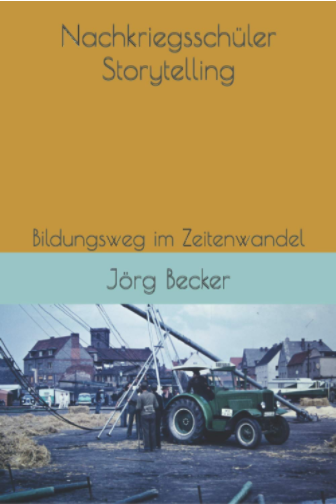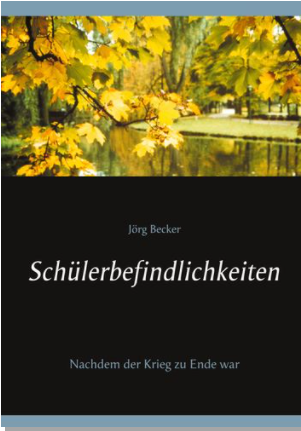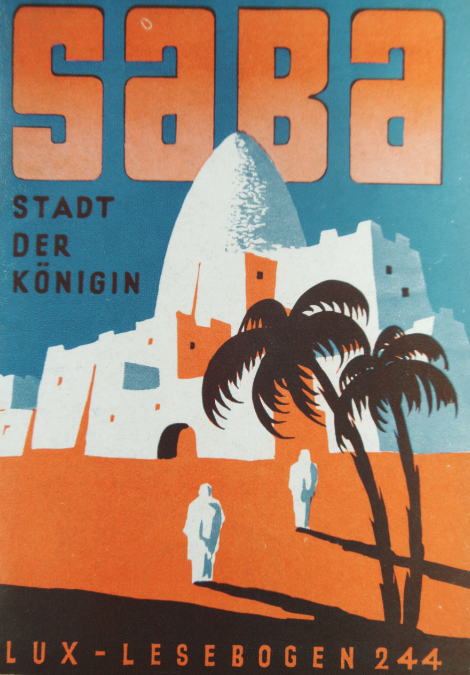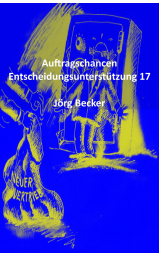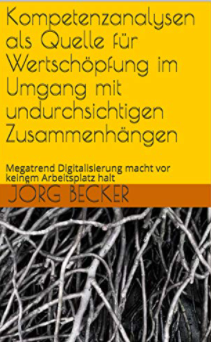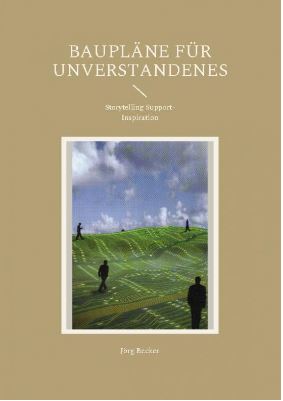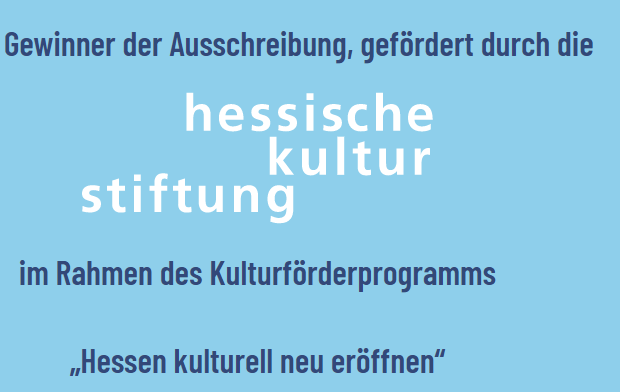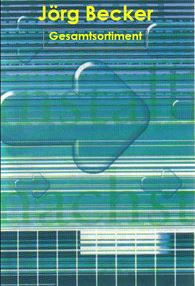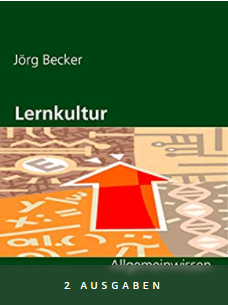Die Erkenntnis, dass der Bildungserfolg vom Lehrer abhängt ist nicht neu. Der Lehrer gehört zu den wirkungsvollsten Einflüssen beim Lernen.
Gute Lehrer können selbst trübe Lichter zum Leuchten bringen.
COACHING-SZENEN EINES AGILEN ÜBERGANGS
Auf Schulwelt folgt Arbeitswelt plus Restwelt
https://www.bod.de/buchshop/coaching-szenen-eines-agilen-uebergangs-joerg-becker-9783734727443
Diplomkaufmann Jörg Becker
Executive Coaching
Autor zahlreicher Publikationen
Langjähriger Senior Manager in internationalen Management Beratungen
Inhaber Denkstudio für strategisches Wissensmanagement
J. Becker Denkstudio – Zielgruppenanalyse für KI-Autoren

Expertenstatus
Vorteil: Man muss kein KI-Entwickler sein, um als Autor erfolgreich zu sein.
- Es genügt, KI-Anwendungen und deren Auswirkungen verständlich darzustellen.
- Interviews mit KI-Experten können Autorität und Glaubwürdigkeit steigern.
Erfolgschance: Wer sich als verständlicher Vermittler positioniert, kann zum gefragten KI-Erklärer werden.
KI auf spezielle Zielgruppen zuschneiden
Vorteil: Viele Menschen wollen wissen, wie KI ihre Branche oder ihren Beruf beeinflusst.
- „KI für Unternehmer“ → Wie Unternehmen KI gewinnbringend einsetzen können.
- „KI im Finanzsektor“ → Wie KI die Geldanlage verändert.
- „KI für Kreative“ → Chancen und Risiken für Künstler, Designer, Autoren.
- „KI und Ethik“ → Gesellschaftliche Herausforderungen und philosophische Fragen.
Erfolgschance: Wer eine spezifische Zielgruppe wie zum Beispiel Mittelständler, Executives, Wissensmanager, Mitarbeiter, Geldanleger, Kreative, Gründer, Bewerber, Bürgermeister oder Wirtschaftsförderer anspricht, hat weniger Konkurrenz und größere Leserbindung.
https://buchshop.bod.de/strategie-im-ki-zeitalter-joerg-becker-9783758339707
Wirtschaftsrechnen als essenzieller Bestandteil der Bildung

Wirtschaftsrechnen sollte ein fester Bestandteil der Bildungswelt sein, weil es die grundlegenden Fähigkeiten vermittelt, um in einer zunehmend komplexen und datengetriebenen Gesellschaft informierte Entscheidungen zu treffen. Intelligenz basiert auf Lernfähigkeit und Anpassungsfähigkeit – beides erfordert eine fundierte Datenanalyse und Kombinatorik, also genau jene Fähigkeiten, die durch Wirtschaftsrechnen geschult werden.
Datenanalyse als Schlüsselkompetenz
Wirtschaftsrechnen ermöglicht das Verstehen und Interpretieren von Daten, sei es im beruflichen oder privaten Kontext. Wer wirtschaftliche Zusammenhänge durch mathematische Methoden analysieren kann, ist besser in der Lage, rationale Entscheidungen zu treffen – ob bei Investitionen, Unternehmensstrategien oder persönlichen Finanzplanungen.
J. #Becker #Denkstudio - #Bildung #Wissen
#Führungskräfte #Coaching #Wirtschaftsmathematik – #Strategische #Kompetenz
https://buchshop.bod.de/fuehrungskraefte-coaching-wirtschaftsmathematik-joerg-becker-9783758371646
#Bildung #Wissen – Inspiration der #Geldanlage im KI-Gespräch – SMART: Ziele sollen spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitgebunden sein
Ein unmoralisches Angebot
Nach jedem Jahrgangsabschluss verliert die Schule im Regelfall den Kontakt zu denen, die sie über viele Jahre hinweg bildungsmäßig aufgepäppelt hat. Die Schule erstellt somit zahlreiche Produkte, weiß aber nie oder selten, was aus ihnen einmal wird. In der Prozesskette fehlt die Endkontrolle. Wo lagen die größten Wertschöpfungspotenziale? Denn wenn Abgänger ihre Schule verlassen haben, durchlaufen sie in ihrem weiteren Leben zahlreiche weitere Anreicherungs-, Transformations- und Umwandlungsprozesse hinsichtlich der im Rahmen der Schulzeiten einmal erlangten Wissensstände.
Klassentreffen sind eine Mischung aus Familienfeier und Betriebsjubiläum, aus Zeitreise, Standortbestimmung und persönlicher Bilanz. Ehemalige Schüler werden in ihre eigene Vergangenheit zurück katapultiert und tun dabei so, als wäre eine zufällige zusammengewürfelte Mannschaft aus vergangenen Tagen auch heute noch wichtig.
https://www.bod.de/buchshop/community-reality-joerg-becker-9783755707745
Aneignung von Wissen und pädagogischer Kompetenz: Nicht Schulstrukturen entscheiden über Leistungserfolge, sondern vor allem die Qualität des Unterrichts sowie die Kompetenzen der Akteure. Hierfür sind manchmal schon die Guten zu wenig: die Besten werden gebraucht.
Ohne das „Beiwerk“ sogenannter „weicher“ Fächer sind jene sogenannten „harten“ Fächer vielleicht überhaupt nicht zu meistern. Man halte sich einmal jene Stress- und Horror-Vision vor Augen, bei der man Tag für Tag geschlagene sechs Stunden immer nur jeweils dem Lehrstoff von Mathematik, Physik, Chemie und Biologie ausgesetzt ist. Vielleicht noch jeden zweiten Tag mit einer saftigen Prüfung garniert. Mit anderen Worten: diese Fächer sind nur möglich, wenn dazwischen auch einmal andere Gehirnregionen angesprochen werden, d.h. ein Schüler vielleicht auch einmal Seele baumeln lassen kann. Musische Bildung mag vielleicht nicht den Leistungsgrad in Sprachen und Naturwissenschaften signifikant verbessern, dürfte in vielen Fällen aber zur inneren Zufriedenheit und Ausgeglichenheit beitragen und somit ein wichtiger Verbündeter gegen das bereits im Schultag mögliche Burn-out-Syndrom sein.
https://www.bod.de/buchshop/vom-schueler-zum-professional-joerg-becker-9783734783562

Was auf der Welt oder bei Klassentreffen auch immer geschieht kann in Texten vermeldet, beschrieben und kommentiert werden. Von Leuten, denen hoffentlich beim Schreiben bewusst war, wie vorläufig, revidierbar und irrtumsanfällig solche Reflexionen und Meldungen immer sein werden. Für gute Erzählungen braucht es dabei nicht nur Sachverstand, sondern fast immer auch Geistesgegenwart. Klassenfeste müssen mit ihren Erzählungen keine Literaturpreise gewinnen: Hauptsache, dass am Schluss keine Frage offen-, kein Widerspruch unaufgelöst, kein Abgrund unausgeleuchtet bleibt.
https://www.bod.de/buchshop/catalogsearch/result/index/?p=5&q=J%C3%B6rg+Becker
J. Becker Denkstudio - Wirtschaftswissen statt Schulzeitverkürzung
Für viele Unternehmen ist es eher unwichtig: ob jemand sein Abitur nun in acht oder neun Jahren gemacht hat, die Verkürzung der Gymnasialzeit ist nicht unbedingt ein Wettbewerbsvorteil im Stellengerangel. Wichtiger als Schulzeitverkürzung sind für den späteren Berufsweg u.a.: Teamfähigkeit, Fähigkeit zum selbständigen Arbeiten, Eigenständigkeit, Berufsorientierung, ordentliches Auftreten, höfliche Umgangsformen, einigermaßen gepflegter Kleidungsstil, Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit.
BLOG KARRIERECOACHING – INTELLEKTUELLES KAPITAL https://www.rheinmaingeschichten.de/blog-karrierecoaching-intellektuelles-kapital/
Fiktive Dialoge - ein paar Stunden Intensivcoaching
Denkanstöße
Wissensmanagement
Storytelling
Content
Inspiration
Diskurs
DecisionSupport
Gehirntraining - wenn es gut werden soll
Verstehen lernen
Vernetzt denken
Potenziale ausschöpfen
Komplexität reduzieren
Gestaltbar machen
Wissen transferieren
Proaktiv agieren
Intellektuelles Kapital hat auch immer mit Ausbildung zu tun. Eine Wissensvermittlung auf Vorrat von früher reicht aber heute bei weitem nicht mehr aus. Qualifizierung ist eine Hol- und weniger eine Bringschuld. Hierzu wird Lernkompetenz benötigt, die zwar mit der Erfahrung aber trotzdem nicht automatisch wächst. Ergebnisse schulischen Lehrens und Lernens sollten u.a. Kompetenz und Können sein. Schulen bewirken manchmal nicht das, was sie in ihren Plänen versprechen. Anleitungen zum entdeckenden und selbständigen Lernen unterstützen beim Wissenserwerb. Aufbau und Pflege von Lernkompetenz ist ein wichtiger Baustein der Personalentwicklung.
So wie es früher beschaulicher zuging, wurden durch den Zeitverbrauch auch viele Alternativen zunichte gemacht (der Druck der Alternativen war geringer). Vieles war einfacher: der Rahmen für Entscheidungen blieb für längere Zeiträume konstant. Die aber im Zeitalter der Beschleunigung aufwachsen, kennen nichts anderes. Alles virtuell und in Echtzeit, darauf kommt es an. Ein Nachlassen des Tempos würde wohl eher als langweilig empfunden. Uralt ist die Sehnsucht der Menschen, fliegen zu können: Göttern und Dämonen schrieb man die Fähigkeit zu, sich in die Luft erheben zu können. Ja man sah im Luftmeer ihren ureigenen Raum.
J. Becker Denkstudio - wie ideale Bildung funktioniert
Die zweckfreie Bildung nach dem Humboldt´schen Bildungsideal steht einer zweckhaften Bildung gegenüber, die nur den beschleunigten Erwerb berufsorientierter Kompetenzen im Sinn hat. Während seinerzeit die Universität ausschließlich als „Ort für wissenschaftliches Nachdenken“, als Hort der Einheit von Forschung und Lehre galt, gilt heute jemand fast schon als Historiker, wenn er überhaupt noch die Tageszeitung liest.
Im Rahmen einer populistischen Grundstruktur der Bildungspolitik setzt sich der Elternwille als einziges Kriterium für die Wahl von Schule und Ausbildungsweg immer mehr durch. Viele Jahre gibt es auch bereits einen Systemstreit (Glaubenskrieg) zwischen Gymnasien und Gesamt- oder Gemeinschaftsschulen. Wobei sich gezeigt hat, dass eine immer weiter gesteigerte Heterogenität nicht ohne Abstriche beim fachlichen Niveau möglich ist. Ohne dieses äußerste Minimum an Exklusivität wird es die Exzellenz nicht geben, von der die Zukunft unserer Gesellschaft abhängt.“
Lehrende müssen über breite, differenzierte, empirische Erfahrungen im Umgang mit Schülern verfügen.
Professionell arbeitende Lehrer erkennen und wissen, wie Schüler auf bestimmte unterrichtliche Arrangements reagieren.
Es geht darum, die Wirkungen konkreter Unterrichtsinhalte auf Schüler zu beurteilen.
Anleitungen zum entdeckenden und selbständigen Lernen unterstützen Schüler bei ihrem Wissenserwerb.
Leistungen und Kompetenz der Schüler lassen sich anreichern, wenn Potentiale des Lernens durch wiederholtes Üben ausgeschöpft und verfestigt werden
direkt zum Katalog der
Deutschen Nationalbibliothek
https://portal.dnb.de/opac.htm?query=Becker+Lesebogen&method=simpleSearch
Sitemap:
Schule = Deutschlands liebste Problem-Institution
Was sind die Ursachen eines immer wieder beklagten Lehrermangels? Haben diese überhaupt etwas mit der Qualität der deutschen Schulen zu tun? Dass vor allem junge Leute lieber in der Stadt als auf dem Land leben wollen, hat nichts mit den Problemen der Schule zu tun. Das gilt genauso für fast allen anderen Berufsgruppen. Und dass der Beruf eines Gymnasiallehrers wiederum attraktiver als der eines Grundschullehrers ist, das kann man auch als ein Ausweichen vor den Problemen der Sozialstruktur sehen: „schließlich weiß schon jeder Lehramtsstudent noch aus dem Schulfach Sozialkunde, dass sich die Kinder aus den bildungsfernen Schichten nun mal in den Grundschulen konzentrieren und eher nicht in der Sekundarstufe 2.“
Elektronische Medien haben das Machtgefälle zwischen Unterrichteten und Unterrichtenden verschoben. Der Kampf um die Aufmerksamkeit für den Stoff ist asymmetrischer denn je: die Verlockungen der Bilder und permanent oder potentiell einschließenden Nachrichten sind unwiderstehlich. Viele Ideen, wie man Handy und Tablet in den Unterricht einbinden kann sind oft von einer technikgläubigen Hoffnung geprägt, nämlich die Faszination der Geräte nutzen und gleichzeitig ihre Nachteile im Zaum halten zu können.
Baupläne für Unverstandenes
https://www.bod.de/buchshop/bauplaene-fuer-unverstandenes-joerg-becker-9783756236107
Grenzen zwischen Bildung und Ökonomie: wenn über Pisa Druck ausgeübt wird, Erziehungs- und Bildungsangebote zu eng an den Standards der Wirtschaft auszurichten, werden die Grenzen zwischen Bildung und Ökonomie überschritten. Der Funktion des Erziehens werden rein ökonomische Denkweisen mit Wachstumsideologien und Renditestreben übergestülpt.
https://www.isbn.de/verlag/BoD+%E2%80%93+Books+on+Demand?autor=J%C3%B6rg+Becker&seite=1
Anzunehmen, dass es in einem Lehrerkollegium so viele gute und schlechte Mitarbeiter gibt, wie in jedem Büro einer Firma ansonsten auch. Von Lehrern aber wird immer mehr abverlangt: wie von einem Top-Manager eines Unternehmens wird von einem Lehrer ganzheitliche Optimierung verlangt, der analog zu Produkten maßgeschneiderte Schulabgänger hervorzubringen habe.
direkt zum Mittelstand:
https://www.beckinfo.de/mittelstand/
direkt zur Wirtschaftsförderung:
https://www.derstandortbeobachter.de/wirtschaftsförderung/
direkt zum Katalog der
Deutschen Nationalbibliothek
https://portal.dnb.de/opac.htm?query=Becker+Lesebogen&method=simpleSearch
 Wissensbasierte Ökonomie
Region RheinMain
Lokale Standortbeobachtungen
Standortbilanz u. Personalbilanz
Wissensbasierte Ökonomie
Region RheinMain
Lokale Standortbeobachtungen
Standortbilanz u. Personalbilanz