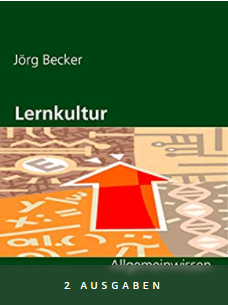Nichts ist mehr so wie es war………………..
Auch ein mittelständisches Unternehmen sollte sich bei der existenziellen Standortfrage nicht nur auf Fremdanalysen und Dritt-Meinungen verlassen. Die Methode der Selbstbewertung kann deshalb für mittelständische Unternehmen ein äußerst erfolgreicher Ansatz sein, um fundierte Entscheidungen bei der Standortwahl zu treffen. In der Praxis zum Beispiel mit folgenden Schritten:
Interne Datenerhebung: Das Unternehmen sammelt interne Daten zu relevanten Standortfaktoren wie Produktionskosten, Logistik, Verfügbarkeit von Fachkräften und Marktpotenzial. Diese Daten stammen aus eigenen Erfahrungen und operativen Ergebnissen.
Mitarbeiterbefragungen: Durch Befragungen der Mitarbeiter können wertvolle Einblicke in die Stärken und Schwächen des aktuellen Standorts gewonnen werden. Mitarbeiter haben oft praktische Erfahrungen und können spezifische Herausforderungen und Vorteile benennen.
Workshops und Brainstorming-Sitzungen: Workshops mit verschiedenen Abteilungen und Teams ermöglichen es, unterschiedliche Perspektiven zu berücksichtigen und kreative Lösungen zu entwickeln. Diese Sitzungen fördern den Austausch von Ideen und die Identifikation von Prioritäten.
SWOT-Analyse: Eine interne SWOT-Analyse (Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken) hilft, die internen und externen Faktoren zu bewerten, die den Standort beeinflussen. Dies ermöglicht eine ganzheitliche Betrachtung der Situation.
Benchmarking: Das Unternehmen vergleicht seine eigenen Daten und Ergebnisse mit denen anderer ähnlicher Unternehmen. Dies hilft, die eigene Position im Markt besser zu verstehen und Best Practices zu identifizieren.
Simulationen und Szenarioanalysen: Durch die Durchführung von Simulationen und Szenarioanalysen können verschiedene Standortoptionen und deren potenzielle Auswirkungen getestet werden. Dies hilft, die besten Entscheidungen auf Basis fundierter Daten zu treffen.
Kontinuierliche Überprüfung und Anpassung: Die Selbstbewertung ist ein fortlaufender Prozess. Regelmäßige Überprüfungen und Anpassungen der Strategie stellen sicher, dass das Unternehmen flexibel auf Veränderungen reagieren kann.
Durch die Methode der Selbstbewertung kann ein mittelständisches Unternehmen seine spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen besser verstehen und fundierte Entscheidungen treffen, die auf eigenen Daten und Erfahrungen basieren. Dies stärkt die Unabhängigkeit und erhöht die Wahrscheinlichkeit, den optimalen Standort zu finden.
Die Selbstbewertung eines Standorts mithilfe zum Beispiel von Simulationen und Szenarioanalysen kann einem mittelständischen Betrieb wertvolle Einblicke und fundierte Entscheidungsgrundlagen bieten:
Fallbeispiel: Selbstbewertung eines Produktionsstandorts
Ziel: Ein mittelständisches Unternehmen möchte die Eignung seines aktuellen Produktionsstandorts bewerten und mögliche Verbesserungsmaßnahmen identifizieren.
Daten sammeln und analysieren
Das Unternehmen sammelt interne Daten zu verschiedenen Standortfaktoren wie Produktionskosten, Logistik, Verfügbarkeit von Fachkräften und Marktpotenzial. Diese Daten werden analysiert, um die aktuelle Situation zu verstehen.
Szenarien entwickeln
Basierend auf den gesammelten Daten werden verschiedene Zukunftsszenarien entwickelt. Diese Szenarien berücksichtigen mögliche Entwicklungen wie technologische Fortschritte, Marktveränderungen und demografische Trends. Beispiele für Szenarien könnten sein:
- Optimistisches Szenario: Technologische Innovationen führen zu Kostensenkungen und Produktivitätssteigerungen.
- Pessimistisches Szenario: Steigende Energiekosten und Fachkräftemangel belasten den Standort.
- Status-quo-Szenario: Die aktuellen Bedingungen bleiben weitgehend unverändert.
Simulationen durchführen
Für jedes Szenario werden Simulationen durchgeführt, um die potenziellen Auswirkungen auf den Standort zu bewerten. Dabei werden verschiedene Variablen wie Kosten, Produktionskapazität und Marktanteil berücksichtigt. Die Simulationen helfen, die möglichen Ergebnisse und Risiken der verschiedenen Szenarien zu quantifizieren.
Bewertung der Ergebnisse
Die Ergebnisse der Simulationen werden analysiert, um die Stärken und Schwächen des Standorts unter den verschiedenen Szenarien zu identifizieren. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, die potenziellen Chancen und Risiken besser zu verstehen.
Maßnahmen ableiten
Basierend auf den Ergebnissen der Simulationen und Szenarioanalysen werden konkrete Maßnahmen entwickelt, um den Standort zu optimieren. Dies könnte die Einführung neuer Technologien, die Verbesserung der Logistik oder die Weiterbildung der Mitarbeiter umfassen.
Kontinuierliche Überprüfung und Anpassung
Die Selbstbewertung ist ein fortlaufender Prozess. Regelmäßige Überprüfungen und Anpassungen der Maßnahmen stellen sicher, dass das Unternehmen flexibel auf Veränderungen reagieren kann und der Standort langfristig wettbewerbsfähig bleibt.
Durch diesen systematischen Ansatz kann ein mittelständisches Unternehmen fundierte Entscheidungen treffen und seinen Standort notfalls verbessern.
https://buchshop.bod.de/business-coaching-joerg-becker-9783739223452
Fiktive Dialoge - ein paar Stunden Intensivcoaching
Denkanstöße
Wissensmanagement
Storytelling
Content
Inspiration
Diskurs
DecisionSupport
Gehirntraining - wenn es gut werden soll
Verstehen lernen
Vernetzt denken
Potenziale ausschöpfen
Komplexität reduzieren
Gestaltbar machen
Wissen transferieren
Proaktiv agieren
Executive Coaching
Denkstudio für strategisches Wissensmanagement
SMART - Ziele sollten SMART (spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitgebunden) sein.
Ein Schlüsselprozess als Diskussionsplattform für Wirtschaftsförderung und Standortakteure: Die Selbstbewertung des Standortes ist ein Schlüsselprozess, der eine Plattform für die Diskussion und Erarbeitung von Themen liefert, mit denen die Wirtschaftsförderung konfrontiert wird und sichert die Mitwirkung und das Engagement von Schlüsselpersonen.
Hierbei befasst sich eine Standortbilanz vor allem auch mit der Bewertung und Messung immaterieller Sachverhalte, also allen „Intangibles“ einer ganzen regional abgegrenzten Einheit. Obwohl dabei versucht wird, größtmögliche Transparenz und (auch quantitative) Nachvollziehbarkeit durch Annäherung an finanzübliche Sichtweisen herzustellen, kommt es nicht so sehr auf die absolute Höhe oder Richtigkeit der Bewertungszahlen an.
Für den überwiegenden Teil der Standortfaktoren sind ohnehin keine Käufe oder Verkäufe möglich. Es existiert kein Markt für Standortfaktoren, auf dem sich ein in Euro und Cent ausdrückbarer Marktpreis darstellen ließe. Wirtschaftsförderer und Standortentscheider können mehr Informationsgewinn eher aus der richtigen Relation und Korrelation zwischen den jeweils identifizierten Standortfaktoren untereinander gewinnen.
Es ist bereits ein schwieriges Unterfangen, einen Standort mit allen Facetten und Dimensionen seiner Standortfaktoren möglichst wirklichkeitsnah abbilden zu wollen. Zu komplex sind manche der Standortfaktoren, zu wenig transparent sind manche dynamische Wirkungsbeziehungen untereinander und zu vieles spielt sich unter der Oberfläche oder hinter den Fassaden des Standortes ab. Wenn schon die Bewertung dieses Jetzt und Heute nicht so einfach ist wie es manchmal scheint, um wie vieles schwieriger dürfte daher eine genaue Analyse des Morgen und Übermorgen sein.
In dem Konzept der Standortbilanz erfolgt die Bewertung von 1. Geschäftsprozessen, 2. Geschäftserfolgen, 3. Humankapital, 4. Strukturkapital und 5. Beziehungskapital des Standortes gemäß einer QQS-Bewertung (Quantität-Qualität-Systematik). Jeder der zuvor identifizierten und beschriebenen Standortfaktoren wird für sich nach den Dimensionen Quantität (Qn), Qualität (Ql) und Systematik (Sy) bewertet und muss ein 3-stufiges Bewertungsschema durchlaufen. Hierbei ist im Rahmen der Standortbilanzierung die Selbstbewertung ein Schlüsselprozess, der eine Plattform für die Diskussion und Erarbeitung von Themen liefert, mit denen die Wirtschaftsförderung konfrontiert wird und sichert die Mitwirkung und das Engagement von Schlüsselpersonen. Damit ist die Selbstbewertung auch ein leistungsfähiger Mechanismus zur Einführung und Unterstützung von Verbesserungsmaßnahmen.
Als Vorteile im Detail bietet das Instrument der Selbstbewertung u.a.: einen gründlichen, strukturierten Ansatz für Verbesserungsaktivitäten, eine Bewertung auf Grundlage von Fakten statt individueller Wahrnehmungen, ein Instrument zur Festlegung eines Orientierungsrahmens und zur Konsensfindung hinsichtlich notwendiger Maßnahmen,- ein leistungsfähiges Diagnoseinstrument, eine objektive Bewertung anhand von praxisbewährten Kriterien, ein Mittel zur Messung der im Zeitablauf erzielten Fortschritte,- ein Instrument, das die Verbesserungsaktivitäten auf diejenigen Bereiche konzentriert, in denen sie am nötigsten sind, eine Methode, die sich auf allen Ebenen anwenden lässt, von einzelnen Bereichen bis hin zum Gesamtstandort sowie- eine Chance zur Förderung und zum Austausch erfolgreicher Methoden.
https://buchshop.bod.de/business-coaching-joerg-becker-9783739223452
 Wissensbasierte Ökonomie
Region RheinMain
Lokale Standortbeobachtungen
Standortbilanz u. Personalbilanz
Wissensbasierte Ökonomie
Region RheinMain
Lokale Standortbeobachtungen
Standortbilanz u. Personalbilanz