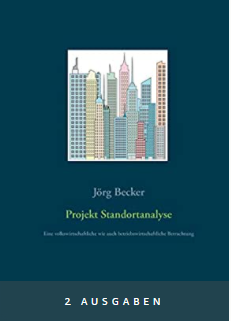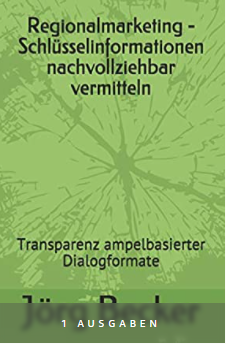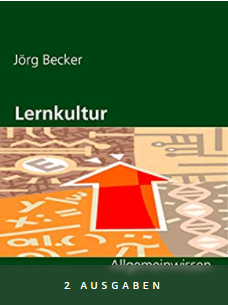J. Becker - Erzählform Coaching
Finanzkrise, Corona, Lockdown, Ukrainekrieg, Inflation oder Energiekrise, was soll noch kommen? Wie geht das alles weiter? Wem kann man heute überhaupt noch irgendwas glauben? Dem Finanzberater? Dem Gesundheitsminister? Wenn viele schon längst nicht zu wissen scheinen, wer sie sind und was sie für wahr halten sollen? Man nennt das Informationsgesellschaft. Und welchen Wert hat ein Bildungssystem, dass neben öffentlichen Einrichtungen auch Herrschaftswissen für die dickeren Geldbeutel oder Privatunterricht gemäß weltanschaulichen Schrullen umfasst? Bevor die allgemeine Unglaubwürdigkeit sich ins Uferlose ausweitet, lohnt sich ein Blick auf eine Erzählform wie das Coaching.
Umwelt-, Kompetenz- und Wissenscoaching
Intellektuelles Kapital ist Trumpf
https://www.bod.de/buchshop/umwelt-kompetenz-und-wissenscoaching-joerg-becker-9783756898473
Coaching-Szenen eines agilen Übergangs
Auf Schulwelt folgt Arbeitswelt plus Restwelt
https://www.bod.de/buchshop/coaching-szenen-eines-agilen-uebergangs-joerg-becker-9783734727443
BUSINESS COACHING
Decision Support mit Ansage
https://www.bod.de/buchshop/business-coaching-joerg-becker-9783739223452
Managementcoaching Standortwissen
Wirtschaftsförderung der Basics
https://www.bod.de/buchshop/managementcoaching-standortwissen-joerg-becker-9783746098463
Diplomkaufmann Jörg Becker
Executive Coaching
Autor zahlreicher Publikationen
Langjähriger Senior Manager in internationalen Management Beratungen
Inhaber Denkstudio für strategisches Wissensmanagement
Eine Welt der Möglichkeiten - Maschine Zufall
Zufall und Wahrscheinlichkeit: die nicht vorhandene, unsichtbare Wahrnehmung wird gefühlt durch die Maschine Zufall ersetzt. Am Anfang steht das Unbekannte, Unzugängliche. Um von der Unsicherheit zum Zufall zu gelangen, muss der Blick innehalten, muss einen in Erstaunen versetzen. Außerhalb der gelebten Wirklichkeit gibt es keinen Zufall. Mit dem Bild des Zufalls wird versucht, die Wirklichkeit begrifflich zu erfassen, sie irgendwie begreiflich zu machen. So soll der Zufall eine Vorstellung vermitteln, ohne etwas der sinnlichen Wahrnehmung oder der reinen Intuition verdanken zu müssen. In der Theorie der Wahrscheinlichkeiten geht es darum, was am Unvorhersehbaren formalisierbar und quantifizierbar sein könnte. Im antiken Griechenland gab es hierfür extra den Gott Chaos, der das repräsentieren sollte, was nicht organisierbar ist. Wie das Universum selbst, scheint diese (fast) unendlich. „Die erste Regel der Wahrscheinlichkeiten lautet, dass die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses die Summe der Wahrscheinlichkeiten aller Möglichkeiten ist, die es realisieren“.
https://www.bod.de/buchshop/wissensmanagement-ist-potenzialmanagement-joerg-becker-9783739202396
Dynamik von Märkten für E-Books
E-Books haben auf dem Markt eine große Dynamik entfaltet: denn dahinter stehen Großunternehmen. Elektronische Bücher kann man nicht in den Mülleimer schmeißen und trotzdem verwirklichen sie so etwas wie eine Wegwerfbewegung, repräsentieren den Vorrang der Quantität vor Qualität. Neue Technologien verändern die Eigenschaften der Dinge. E-Books können das traditionelle Buch ergänzen (vielleicht sogar bereichern), aber wohl nicht ersetzen. „Richtige Bücher sind lange haltbar. Hundertfünfzig Jahre alte Bücher sind keine Seltenheit und oft nicht einmal teuer. Wie wahrscheinlich ist es, dass unsere Nachkommen in anderthalb Jahrhunderten die Schönheit und handwerkliche Verarbeitung alter E-Books bewundern werden „. Ein gedrucktes Buch kann man mit Anmerkungen, Einwänden oder Unterstreichungen wichtiger Passagen versehen.
https://www.bod.de/buchshop/hoert-man-auf-treibt-man-zurueck-joerg-becker-9783756216109
Blog Karrierecoaching - Intellektuelles Kapital
BLOG KARRIERECOACHING – INTELLEKTUELLES KAPITAL https://www.rheinmaingeschichten.de/blog-karrierecoaching-intellektuelles-kapital/
Fiktive Dialoge - ein paar Stunden Intensivcoaching
Denkanstöße
Wissensmanagement
Storytelling
Content
Inspiration
Diskurs
DecisionSupport
Gehirntraining - wenn es gut werden soll
Verstehen lernen
Vernetzt denken
Potenziale ausschöpfen
Komplexität reduzieren
Gestaltbar machen
Wissen transferieren
Proaktiv agieren
Viele stellen sich die Frage, ob es vielleicht ein so so seltener Zufall (der sich im gesamten Universum nur einmal abgespielt hat) gewesen sei, der zur Entstehung des Lebens geführt habe (dann wären wir allein). Oder „war es in einer ähnlich zusammengesetzten Ursuppe auf einem ähnlich beschaffenen Himmelskörper tatsächlich unvermeidlich, dass sich aus Materie Leben formt?“. Manche Forscher glauben, „dass es ein Programm gegeben haben muss, nach dem der Mensch bereits im Urknall angelegt gewesen sei. Die physikalischen Bedingungen hätten für Konvergenz gesorgt, also dafür, dass alles so kam, wie es kommen musste. Flügel mussten entstehen, weil es Luft gab, Flossen waren nötig, weil es Wasser gab“. Aber eine Tatsache ist auch: „dass die überwältigende Mehrheit aller jemals entstandenen Arten im Laufe der Erdgeschichte auf der Strecke geblieben ist.
https://www.bod.de/buchshop/nichts-ist-gewiss-joerg-becker-9783750408562
Denkstudio - Coaching Handel Scorecard
Handelsunternehmen-BSC: wichtig für das BSC-Konzept ist in diesem Fall, dass die Besonderheiten des Handels ausreichend berücksichtigt werden, so beispielsweise die Sortiments- und Lieferantenauswahl, die Sortimentsattraktivität (Fast-Seller-Quote), die Leistungsbereitschaft der eingesetzten Informationstechnologien oder die Qualität der Lieferantenbeziehungen. Aber nicht nur die Auswahl der Kennzahlen ist wichtig, sondern auch deren Gewichtung, die von Branche zu Branche (und von Unternehmen zu Unternehmen) unterschiedlich sein dürfte. D.h. es geht um die Relevanz der spezifischen Leistungstreiber des Unternehmens. Ergänzt und ggf. erweitert werden kann das Konzept der Balanced Scorecard durch das Konzept der Wissensbilanz.
https://www.bod.de/buchshop/selektiv-joerg-becker-9783755794073
Eine Standortbilanz stellt für Kommunen einen weiteren Kommunikationskanal dar, um die Ressourcen und qualitativen Vorteile des Standortes nach außen zu tragen. Das Konzept einer Standortbilanz verbindet Selbst- mit Fremdeinschätzung und bietet somit zweierlei Mehrwert: einerseits wird damit die Selbstwahrnehmung des Standortes analysiert, andererseits wird die Wahrnehmung aus Sicht von Investoren hinterfragt. Komplexe und unübersichtliche Zusammenhänge lassen sich so aufbereiten, dass sie für den Entscheidungsprozess eingesetzt werden können. Handlungsbedarfe können nachvollziehbar kommuniziert werden.
Standortbeobachtung - Hanau, Friedrichsdorf, BadHomburg
Spezifische Fähigkeiten und Potenziale eines Standortes sind auch in Köpfen gespeichert: als "Kopfschätze"
https://www.bod.de/buchshop/schicksal-standort-joerg-becker-9783739218533
Nicht alle Standorte profitieren gleichermaßen von der weltweiten Vernetzung oder vom Wegfall von Handelsschranken. Schwer haben es Regionen mit Produkten, die kein großes Knowhow erfordern (weshalb es umso mehr auf die Lohnkosten ankommt). Wie beispielsweise die Schwerindustrie (Ruhrgebiet), die Textilindustrie (Niederrhein) oder die Schuhfabriken (Hinterpfalz). Oder: Oberfranken mit seinem Fokus auf Keramik, Spielwaren, einfachen Haushalts- und Elektroartikeln. Längst sind andere Länder in der Lage, solche Produkte kostengünstiger herzustellen.
Erfolg mit vielen Unbekannten
Zufall und Glück lassen auch den Untüchtigen den Trost der Ungerechtigkeit der Welt und geben ihnen zumindest psychisch gesehen einen Rechtfertigungsgrund, Misserfolg und Scheitern anderen Umständen (Pech, falsches Timing, schlechte Gene) zuzurechnen. D.h. Glück und Zufall sind (und werden immer sein) die großen Unbekannten der Leistungsgesellschaft.
“Wer den Zufall ausmerzen wollte, müsste alle Neugeborenen ihren reichen Eltern entziehen und sie in internationalen Erziehungscamps nach identischen Methoden aufwachsen lassen“. Erfolg ist aufgrund der Bestimmungsfaktoren Glück und Zufall kein Grund zur Überheblichkeit. Der Mensch neigt dazu, erfolge sich selbst, Misserfolge eher widrigen Umständen zuzuschreiben. Aber es kommt nicht nur darauf an, erfolgreich gewesen zu sein. Wichtig wäre auch zu erfahren, ob der Erfolgreiche diese Tatsache sich allein selbst zu verdanken hat.
https://www.bod.de/buchshop/catalogsearch/result/index/?p=7&q=J%C3%B6rg+Becker
Odenwald, Taunus, Spessart - Wind Energie
Interessant ist Big Data immer dann, wenn es gelingt, aufgrund der gesammelten Daten künftige Entwicklungen (präzise) vorherzusagen. Beispielweise: wenn man Daten zum Wirtschaftswachstum und zur Kaufkraftentwicklung mit dem Einkaufsverhalten im Internet kombiniert, um daraus (regional differenziert) abzuleiten, wie hoch der Bedarf an Logistik- und Einzelhandelsflächen sein wird. Oder: wenn Suchanfragen bei Wohnungsportalen im Internet, Buchungen bei Zimmervermittlern und die Handydichte miteinander kombiniert werden, um daraus die künftige Attraktivität bestimmter Stadtteile bei der Wohnortwahl zu berechnen. Wenn es in einem Gebiet mehr Handys als Einwohner gibt, wird dies von ‚Analysten als Zeichen dafür gewertet, dass dieses Gebiet an Attraktivität gewinnt.
https://www.bod.de/buchshop/catalogsearch/result/index/?p=4&q=J%C3%B6rg+Becker
Internet - wie ein Zimmer ohne Mauern
Das Medium ist die Botschaft. „Das Mittel, das unsere Botschaften hin und her transportiert, definiert und beeinflusst diese Botschaften maßgeblich“: die Liebesbriefe der Romantik gingen noch ganz anders mit der Liebe und ihren Wünschen um, als es heute per SMS geschieht“. So oft oder so stark sich Menschen auch gegen Apparaturen des Fortschritts (den sie gleichzeitig an anderer Stelle immer mehr beschleunigen wollten) gestellt haben mögen, so wenig hat dies genutzt oder geändert. Bekommt jemand ein Smartphone in die Finger und schon beginnt er zu drücken: in einem unübersichtlichen Gewirr von Absichten, Emotionen, Erfahrungen, Erwartungen. Im Internet hantiert man wie in einem Zimmer, dessen Mauern bis nahe auf den Grund abgetragen sind.
Personalbilanz Lesebogen 313 – Mittelstand mit Kommunikations-, Wissens- und Planungs-Plattform
J. Becker Denkstudio - Wissen Management
Business Analyse - Ökonomie des Lebens
Das Internet der Dinge verspricht wahre Wunderding wie u.a. schlaue Häuser, selbstfahrende Autos, den Schlaf steuernde T-Shirts, Puls messende Pflaster, selbst nachbestellende Kühlschränke oder Autos aus dem 3D-Drucker. „Es gibt keinen anderen Fortschritt als den, den es gibt: die Gegenwart war schon alternativlos, als sie noch Zukunft war.“ So waren die 60er Jahre eine Ära schöpferischer Zerstörung angeblicher kapitalistischer Systemzwänge. Die Diktatur der Ökonomie über die Menschen wurde vor dem Hintergrund stetigen Wachstums für endgültig besiegt erklärt. Aus heutiger Sicht scheint es, dass dies nur eine Zwischen- und Übergangsphase war, denn: Erwerbsarbeit dringt mittlerweile tiefer denn je in das Alltagsleben ein, Aufbau von Humankapital ist zu einem zentralen Thema geworden, Karriereplanung beginnt bereits im Kindergarten, das Individuum verwirklicht sich in seiner höchsten Form als Ich-AG, Konsum wird grenzenlos, die Durchökonomisierung aller Lebensbereiche schreitet fort.
https://www.amazon.de/Zeitalter-Beschleunigung-Entgrenzung-verpasst-Gelegenheit-ebook/dp/B07N1QN9KW
Turbulenzen - Komplexität und Dynamik
In turbulenten Zeiten verflüssigt sich alles Festetablierte. Es kommt darauf an, die wesentlichen Treiber der Veränderungen auszumachen und auch vielleicht nur flüchtige Zusammenhänge aufzuspüren. Als wesentliche Ursachen und Einflussfaktoren für die Zunahme von Turbulenzen gelten Komplexität und Dynamik. Überraschungen und unvorhergesehene Entwicklung sind an der Tagesordnung: Probleme und Ereignisse, die sich quasi über Nacht in das Bewusstsein drängen und mehr als alle vorherigen plötzlich nach ungeteilter Aufmerksamkeit verlangen. Ein Problem besteht für Standortakteure darin, die für sie strategisch wichtigen Entwicklungen auszufiltern. Denn schon allein aus Kapazitätsgründen können sie sich meist nur mit einer begrenzten Zahl der neu auf sie einstürmenden Tatbestände gleichzeitig auseinandersetzen. In den trivialen Niederungen von Standortthemen sollten die Erwartung an hierbei spektakuläre Erkenntnisse nicht zu hoch angesetzt werden.
J. Becker Denkstudio - Amazon OnlineShop
Ernst Becker Stettin Hanau - Eroberung der Luftmeere
Der Weg "leichter als die Luft" führte zur Eroberung der Luftmeere durch die Menschen
https://www.amazon.de/Zeitspr%C3%BCnge-J%C3%B6rg-Becker/dp/B084Z4Z752
Prämissen, die in den Algorithmen stecken
Durch die Veränderung der Perspektive lassen sich wenigstens die Umrisse der Probleme erkennen, welche durch moderne Technologien verstärkt und vor allem verschleiert werden: so wichtig es ist, die Prozesse zu untersuchen, die innerhalb der Black Box im Herzen einer technisierten Gesellschaft ablaufen, die Architektur der Software und die Infrastruktur der Hardware, so kurzsichtig ist es, sich auf die immanenten Schwachstellen und Fehler zu konzentrieren.
Nur weil wir nicht alles verstehen, dürfen wir nicht aufhören zu denken: die Fähigkeit zu denken, ohne zu behaupten oder sogar zu versuchen, etwas komplett zu verstehen, ist der Schlüssel zum Überleben im neuen Dark Age. Es geht nicht um Formeln oder Codes, aus denen Algorithmen gemacht sind, sondern um die Prämissen, die ihnen im Blut stecken. Um die Erfahrungen, Vorurteile und Interessen. Um alle Daten, aus denen ein Gefängnis der Vergangenheit errichtet würde, wenn man sich die Zukunft nur noch als Hochrechnung der herrschenden Verhältnisse vorstellen könnte.
https://www.amazon.de/Zeitspr%C3%BCnge-J%C3%B6rg-Becker/dp/B084Z4Z752
Immobilien im Wandlungsprozess und Möglichkeitsraum
Wie zahlreiche andere Branchen auch, ist auch die Immobilienwirtschaft einem dynamischen Wandlungsprozess ausgesetzt. Nach Meinung von Experten bieten Immobilien gute Voraussetzungen, um für Datenanalysten attraktiv zu sein. Die Betreiber von Einkaufszentren kennen beispielsweise die Umsatzentwicklung jedes einzelnen Shops, die Passantenfrequenz an jedem einzelnen Tag, zu jeder Stunde.
Kreativität - eine Domäne des Menschen?
Zwar können Computerprogramme Quizfragen beantworten oder medizinische Diagnosen erstellen. Aber was ist mit einer weiterer Domäne des Menschen: der Kreativität? Ist Kreativität so etwas wie ein Etikett, das man auf kognitive Prozesse klebt, solange man sie nicht versteht?
https://www.amazon.de/Kommunikationsblase-Ungewissen-Kunst-Zeichen-lesen/dp/3755782669
Geeignete Tools für eine Ökonomie des Standortes
Die Standortökonomie hat die Aufgabe, komplexe und unübersichtliche Zusammenhänge so aufzubereiten, dass sie für den Entscheidungsprozess (die Entscheidungssituation vor Ort ist auch durch soziale und kommunikative Prozesse geprägt, vieles läuft auf der sozialen und emotionalen Ebene ab) eingesetzt werden können. Eine Standortbilanz verschafft nicht nur der Kommune selbst, sondern insbesondere auch ortsansässigen und ansiedlungsinteressierten Firmen einen konkreten Vorteil in Form qualifizierter, nachvollziehbarer Standortinformationen.
SB Lesebogen 01 – Kriterien und Einflussfaktoren
Analoge Gegenwart und digitale Zukunft
Zwischen analoger Gegenwart und digitaler Zukunft des Buches sitzt Ratlosigkeit. Ein Verlag, der seiner Neuerscheinung eine gute Position auf den Verkaufstischen sichern möchte (muss), muss dafür viel zahlen (Rabatte, Warenkostenzuschuss u.a.): die einstige Verkaufsmacht ist dahin, Buchhändler auf dem flachen Land sterben aus.
J. Becker Denkstudio - Amazon OnlineShop
https://www.amazon.de/~/e/B0045AV5YQ
Grundsätzlich schwanken viele zwischen analoger Vergangenheit und digitaler Zukunft. Die Drehgeschwindigkeit der Verlagsprogramme beschleunigt sich. Bücher tragen mehr und mehr die Handschrift von Marketingabteilungen (und weniger die eines Lektorats). Die Frage ist nicht mehr: will ich dieses Buch verlegen, weil ich es für ein wichtiges Buch halte? Sie lautet: kann ich es verkaufen und, wenn ja, wem? Es findet eine „permanente Ökonomisierung geistiger Landstriche statt“: was nicht geht kommt nicht in das Sortiment hinein. Diese Logik bringt einerseits den gesamten Markt ins Wanken, bietet aber anderseits auch dem unabhängigen Eigenverleger die Chance zur Eigenproduktion. Das Angebot an digitalen Buchinhalten steigt. Wer sich nicht bewegt, wird in einem solchen dynamischen Umfeld nicht erfolgreich sein (ein Anrecht auf Überleben gibt es nicht). Die Preisdynamik erhöht zusätzlich den Druck der Wechselbäder dieses Geschäftes.
https://www.bod.de/buchshop/catalogsearch/result/index/?p=5&q=J%C3%B6rg+Becker
J. Becker Denkstudio - Kommunikation mit Strategie
Was nicht gespeichert ist, hat nicht stattgefunden, ist demnach kein Wissen?
Wenn es um das große Ganze geht
Mit Big Data werden auch räumliche Modelle entwickelt, die Preisunterschiede von Wohnimmobilien adressgenau abbilden. Die Kunst dabei: herauszufinden, welches die richtigen Quellen (Big Data per se ist noch kein Mehrwert) und die richtigen Algorithmen sind. Schwierigkeiten ergeben sich daraus, dass Immobilien Einzelstücke sind, deren serielle ‚Erfassung und Bearbeitung nur beschränkt möglich ist. Genaue Daten zu Immobilientransaktionen werden zudem immer nur mit großer Verzögerung ausgewiesen. „Wer immer über geheime, wertvolle Informationen aus dem Immobilienmarkt verfügt, wird sie lieber für sich behalten und allein verwerten. Schließlich geht es fast immer ums große Geld.“
Kultur des Erfolges
Die Optimierung des Selbst erfasst immer mehr Lebensfelder und –beziehungen, d.h. es geht längst nicht mehr nur noch um Beruf und Karriere. Die moderne Kultur des Erfolges ist ein sich selbst verstärkender Prozess: Unscheinbare Erfolge zählen im Klima einer Erfolgsfixierung nichts. Es geht um Sichtbarkeit und Ranglisten. Nur sichtbare (möglichst für alle) Erfolge zählen wirklich. Unzählige Ratgeber befeuern dieses Denken und Fühlen. Nur die Erfolglosen verharren unscheinbar in ihrem stillen Kämmerlein.
https://www.bod.de/buchshop/hoert-man-auf-treibt-man-zurueck-joerg-becker-9783756216109
Rhein, Neckar, Main - Performance Development
Obwohl reale Orte in Zeiten heutiger Kommunikationsmittel angeblich an Bedeutung verlieren (weil der Anschluss nirgendwo verlorengeht), verstärken in Wahrheit gerade die sozialen Medien die Anziehungskraft des urbanen Lifestyles. Auch die beruflichen Chancen und Bildungsangebote treiben viele Menschen aus benachteiligten Regionen in die Ballungszentren. Benachteiligte Regionen verlassen vor allem jene, die über eigene Ressourcen, einen gewissen Bildungsstand und Netzwerke verfügen. In abgehängten Regionen führt das zu einer Abwärtsspirale, die Region blutet aus und auch diejenigen, die bleiben, haben weniger Chancen. „Wichtig ist die Aufrechterhaltung vieler verschiedener Einrichtungen öffentlicher Daseinsvorsorge mit Schulen, Fachhochschulen, Berufsberatung oder Jobcenter, Post und vielem mehr“. Damit eine Negativspirale ihren Sog verliert, müssen neue Projekte in regionale Strukturen eingepasst werden.
https://www.bod.de/buchshop/wissensintensives-neudenken-joerg-becker-9783754374597
Dokumentation Intellektuelles Kapital
Grundsätzlich vorteilhaft ist die Erfassung des Intellektuellen Kapitals (Wissen, Kreativität u.a.) vor allem deshalb, weil übliche Bilanzen nur die finanzielle und materielle Vergangenheit widerspiegeln. Es ist auch immer das Ungewisse, d.h. die sogenannten „weichen“ Faktoren, die Märkte vorantreiben. Die Beschäftigung mit dem Intellektuellen Kapital eröffnet Wege, sich die Sensibilität für Veränderungen zu bewahren. Unternehmen, die sich einzig auf materielle Faktoren verlassen, werden träge und weniger sensibel gegenüber Marktveränderungen. Das Gefühl für den Markt sollte in einer Kombination aus Intuition und scharfem Gespür entwickelt werden (man muss den Markt erleben und einatmen).
https://www.bod.de/buchshop/catalogsearch/result/index/?p=25&q=J%C3%B6rg+Becker
J. Becker Denkstudio - Content Management
Im digitalen Zeitalter gibt es nicht für alle nur frohe Botschaften: im Bereich der Kreativwirtschaft gerieten vor allem die Musik- und Filmindustrie in unruhige Fahrwasser. Beim genaueren Hinsehen zeigt sich, dass die Kreativwirtschaft (Buchverlage, Magazine, Firm, Fernsehen, Musik) zwar nicht mehr so stark wachse wie vor dem Internetzeitalter, deshalb aber nicht vor dem Abgrund stehe. Sondern im Gegenteil noch über viele noch nicht ausgeschöpfte Potenziale verfügen könne. Zwischen den einzelnen Teilbranchen zeichnen sich allerdings deutliche Unterschiede ab: Im Vergleich zu den Verlierern (Musik, Magazine) haben andere (Buchbranche, Film, Fernsehen, Computerspieleindustrie) zugelegt.
https://www.bod.de/buchshop/catalogsearch/result/index/?p=9&q=J%C3%B6rg+Becker
Pädagogische Kompetenz
Reformen der Bildungsstrukturen bewirken wenig, solange sie nicht von solcher Qualität der Lehrenden und deren im Schulalltag gezeigten Haltungen mit Leben gefüllt werden. Aneignung von Wissen in Unterrichtsfächern muss immer eng mit pädagogischer Kompetenz gekoppelt werden. Keiner Schulform gelingt es, vom ökonomischen Status losgelöste Bildungserfolge zu erzielen.
J. Becker Denkstudio - Amazon OnlineShop
Computer based personality
Gibt es so etwas wie eine „Computer-based-personality“? Tech-Konzerne sind von der Idee beseelt, mit „technosozialem Engineering“ menschliches Verhalten nicht nur zu analysieren, sondern auch zu steuern. Der freie Wille wird zu einer binären Zahlenlogik kodiert, die auf ökonomische Verwertbarkeit ausgerichtet ist. Der Mensch wird nicht mehr in Worten, sondern in mathematischen Formeln erzählt.
https://www.bod.de/buchshop/wissensintensives-neudenken-joerg-becker-9783754374597
J. Becker Denkstudio - Standort Analyse
Sind nicht Wissenschaftler so etwas wie die Dichter der modernen Welt? Leider liegen die Dinge noch nicht so. Es fehlt noch viel. So ist auch die Mathematik nicht die Dichtkunst, die Dichtkunst ist nicht die Mathematik der Phantasievorstellungen. Und Ingenieure sind auch nicht die Dichter der Wirklichkeit.
https://www.bod.de/buchshop/catalogsearch/result/index/?p=19&q=J%C3%B6rg+Becker
Das Unausdrückbare ausdrücken
Dichtkunst ist noch immer das, was sie schon immer war: ein langsames, wenig präzises Mittel, das Unausdrückbare auszudrücken, ein oft mühsamer Prozess der Annäherung und Verallgemeinerung. Und so ist auch die Wissenschaft zuerst einmal ein Mittel, sich der Wirklichkeit zu nähern. Will man aber eine Wissensbilanz als Landkarte des Wissens aufstellen, muss darin immer auch die Kreativwirtschaft enthalten sein.
J. Becker Denkstudio - Amazon OnlineShop
Wo gibt es bezahlbaren Wohnraum?
In vielen Städten finden sich kaum noch Wohnungen für weniger als zehn Euro Kaltmiete je Quadratmeter. Fachleute sehen in ganz Deutschland auf Brachen und Baulücken noch ein Potential von mehr als 120.000 Hektar Bauland. Ein Fünftel davon sei sofort aktivierbar (sofern die Städte überhaupt wüssten, welche Flächen in Frage kämen). Obwohl die Mieten in Rekordhöhen gestiegen sind und Wohnungen Mangelware sind, regt sich überall Widerstand der Bürger die befürchten, dass ihre eigene Stadt ihr Gesicht verlieren könnte. Bei wohlhabenden Anwohnern sind gerade günstige Sozialwohnungen besonders unbeliebt (Projekte im geförderten Wohnungsbau).

Startup-Betriebswirtschaft - Ressourcenlenkung und Betriebswirtschaft
Den Kurs nach Marktrealitäten steuern
Direkt zum Buchshop:

City-Marketing entwickelt Strategien zur Vermarktung von Städten. Dabei wird eine Stadt ähnlich wie ein Produkt gesehen., d.h. dieses Produkt „Stadt“ muss ein attraktives und vielfältiges Angebot in allen Lebensbereichen bieten.
direkt zum Katalog der
Deutschen Nationalbibliothek
https://portal.dnb.de/opac.htm?query=Becker+Lesebogen&method=simpleSearch
Sitemap:
Infrastruktur und Urbanisierung
Auch die öffentliche Infrastruktur hat nicht mit der zunehmenden Urbanisierung Schritt halten können. Kindergarten, Schulplätze, Verkehrsinfrastruktur: alles knapp geworden in deutschen Großstädten. Urbanisierung gekoppelt mit träger Bautätigkeit ist eine in vielen Ländern zu beobachtende Entwicklung.
J. Becker Denkstudio - Amazon OnlineShop
J. Becker Denkstudio - Strategie Planung
Online-Shopping ist weiter auf dem Vormarsch. Und zwar so stark, dass viele Einkaufszentren und Konsumtempel des Einzelhandels mit stark rückläufigen Entwicklungen zu kämpfen haben. „Destination“ zu sein, genügt nicht mehr: es muss auch gekauft und konsumiert werden (viele Beine, wenig Scheine). Jedes Einkaufszentrum benötigt auch in Zukunft einige große Ankermieter. Erwartet werden nicht unbedingt Luxuslabels, eher einige lebensmittelnahe Geschäfte wie Apotheken oder Reformhäuser.
https://www.bod.de/buchshop/catalogsearch/result/index/?p=6&q=J%C3%B6rg+Becker
Landkarte des Wissens
Ein Wissensbilanz-Projekt zur Erstellung einer Landkarte des Wissen ist stark strategiebezogen und erfordert einen ganzheitlichen Ansatz aus Funktionen, Verantwortlichkeiten, Prozessen und Technologien. Das heißt, ein solches Projekt weist aufgrund der Strategiebezogenheit eine im Vergleich zu anderen Projekten höhere Komplexität auf und erfordert deshalb eine längere Zeitdauer, intensivere Inanspruchnahme der Mitarbeiter, höheren Aufwand, stärkere Einbeziehung und Beteiligung des Managements und höhere Veränderungsbereitschaft (Change Management).
J. Becker Denkstudio - Amazon OnlineShop
Zustand erweiterten Bewusstseins
Wandel ist ein ständiges Fließen von Umgestaltung und ist nicht die Folge irgendeiner Kraft, sondern eine nahezu natürliche Tendenz, die allen Dingen und Situationen schon von Vornherein innezuwohnen scheint. Genauso wie das Rationale und das Intuitive komplementäre, sich ergänzenden Formen des Denkens sind. Rationales Denken ist linear, fokussiert, analytisch. „Es gehört zum Bereich des Intellekts, der die Funktion hat, zu unterscheiden, zu messen, zu kategorisieren. Dementsprechend tendiert rationales Denken zur Zersplitterung. Intuitives Wissen dagegen beruht auf unmittelbarer, nichtintellektueller Erfahrung der Wirklichkeit, die in einem Zustand erweiterten Bewusstseins entsteht“. Es ist ganzheitlich, nichtlinear und strebt nach Synthese.
https://www.bod.de/buchshop/catalogsearch/result/index/?p=20&q=J%C3%B6rg+Becker
Rechenschaftsbericht eines Standortes
Chancen und Risiken lassen sich für einen Standort besser mit Hilfe einer Gesamtschau herausfinden und bewerten. Dabei müssen auf Grundlage einer mehrschichtigen Sichtweise alle Einflussfaktoren möglichst lückenlos einbezogen werden. Die Standortbilanz bietet eine umfassende, für jedermann verständliche Kommunikationsplattform, über die sich alle wichtige Akteure wie Stadtverwaltung, Projektentwickler, Betreiber, Investoren, Einzelhändler, Dienstleister oder Bürgervertreter vernetzen können.
Unternehmen, die wie selbstverständlich ihren Berichts- und Rechnungslegungspflichten zu den dafür festgelegten Zeitpunkten nachkommen müssen, sollten darauf bestehen, dass auch der Standort ihnen von Zeit zu Zeit in Form eines Rechenschaftsberichtes nachweist, dass er für sie geeignet ist.
J. Becker Denkstudio - Erfolg Planung
Einzelhandel - Anbindung an die Online-Welt
Der richtige Ladenmix ist wichtig: große Geschäfte und Marken ziehen die Kunden an. Ebenso wie kostenlose Parkplätze und leichte Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln; weniger Textilhändler, dafür mehr Gastronomie, Lifestyle und Unterhaltung. Unabdingbar ist eine Anbindung an die Online-Welt: damit Kunden zuhause die Käufe vornehmen (über die eigene Homepage des Einzelhandels), die sie nicht schon vor Ort getätigt haben.
Baupläne für Unverstandenes
https://www.bod.de/buchshop/bauplaene-fuer-unverstandenes-joerg-becker-9783756236107

Lohn der Schule
Direkt zum Buchshop:
https://www.bod.de/buchshop/lohn-der-schule-joerg-becker-9783739222967
Instabiler Welthandel
Achtzig Prozent des Welthandels läuft durch Länder, deren politische Stabilität sinkt. Krisen wie beispielsweise Corona scheinen einige der Trends, die Lieferketten der Welt schon bestimmt haben, zu beschleunigen, einschließlich der Regionalisierung von Handels- und Fertigungsnetzwerken, wachsender Digitalisierung und der Fokussierung auf die Nähe zu Verbrauchern. Dies könnte auf eine Kombination hinauslaufen, die das Nach-Hause-Holen von Fertigung oder das Verlagern in nähere Fertigungsländer beinhaltet. Dabei verringert die steigende Automation in der Fertigung die Bedeutung niedriger Arbeitskosten.
https://www.bod.de/buchshop/wissensintensives-neudenken-joerg-becker-9783754374597

Nachdem Stettin durch den Krieg von seinen Einwohnern entvölkert wurde, verschlug es viele von ihnen in die Rhein-Main-Region. Davor ein herausragender Standort, danach für blühende Landschaften Fehlanzeige. Die Qualitäten eines Standortes sind nicht für die Ewigkeit gemacht.
Fähigkeit, sich in die Lüfte zu erheben
So wie es früher beschaulicher zuging, wurden durch den Zeitverbrauch auch viele Alternativen zunichte gemacht (der Druck der Alternativen war geringer). Vieles war einfacher: der Rahmen für Entscheidungen blieb für längere Zeiträume konstant. Die aber im Zeitalter der Beschleunigung aufwachsen, kennen nichts anderes. Alles virtuell und in Echtzeit, darauf kommt es an. Ein Nachlassen des Tempos würde wohl eher als langweilig empfunden. Uralt ist die Sehnsucht der Menschen, fliegen zu können: Göttern und Dämonen schrieb man die Fähigkeit zu, sich in die Luft erheben zu können. Ja man sah im Luftmeer ihren ureigenen Raum.
J. Becker Denkstudio - Amazon OnlineShop
Zukünftige Ordnung der Dinge
Roboter und Algorithmen bestimmen zunehmend das Geschehen und verändern Produktionsabläufe und Beschäftigungsfelder. An den Ufern neuer Datenmeere stehend wäre es wohl zu einfach, diese (nur weil man deren Bedeutung und Umfang nicht versteht) einfach als zukünftige Ordnung aller Dinge zu akzeptieren. Es ist ein flüchtiger Alltag mit fortlaufend abgeschöpften „Datenabgasen“, Datenschnipseln aller Online-Aktivitäten.
J. Becker Denkstudio
direkt zum Wirtschaftswissen:
https://www.beckinfo.de/wirtschaftswissen/
direkt zur Akquisition:
https://www.derstandortbeobachter.de/akquisition
direkt zum Katalog der
Deutschen Nationalbibliothek
https://portal.dnb.de/opac.htm?query=Becker+Lesebogen&method=simpleSearch
Risiken im Wirtschaftsleben
Erwartbare Geschäftsunterbrechungen: Regulierung, lokaler Krieg, akutes klimatisches Ereignis. Unerwartete Geschäftsunterbrechungen: Fälschung, Diebstahl, Lieferanteninsolvenz, Cyberattacke, Katastrophe. Analysen gehen davon aus, dass Unternehmen aufgrund Unterbrechungen in ihrer Lieferkette etwa alle zehn Jahre mehr als vierzig Prozent eines Jahresgewinns vor Steuern verlieren könnten. Aber ein einziger, schwerer Zwischenfall, der die Produktion für hundert Tage lahmlegt und durchschnittlich alle fünf bis sieben Jahre auftritt, kann in einigen Branchen einen ganzen Jahresgewinn ausradieren. Am stärksten gefährdet seien Unternehmen im Bereich Kommunikationstechnik und Kleidung, am wenigsten Hersteller von Medizintechnik und Nahrungsmitteln.
J. Becker Denkstudio - Amazon OnlineShop
 Wissensbasierte Ökonomie
Region RheinMain
Lokale Standortbeobachtungen
Standortbilanz u. Personalbilanz
Wissensbasierte Ökonomie
Region RheinMain
Lokale Standortbeobachtungen
Standortbilanz u. Personalbilanz